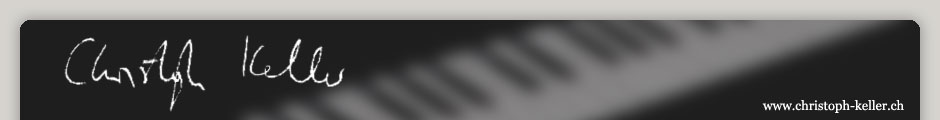Die authentische Eroberung Beethovens
Als ich vor etwa anderthalb Jahren am Fernsehen den Dirigenten Vaclav Neumann unter blau-weiss-roten Fahnen und Transparenten des tschechischen Bürgerforum seines Amtes walten sah, brachten mich die Draperien eher als die erklingende Musik auf den Gedanken, dass auf den Pulten der Orchestermusiker die Stimmen von Beethovens 9. Symphonie lagen; ich war dem Staatsakt-Tempo, wie Neumann es zelebrierte, seit so langem entwöhnt, dass ich es im Kopf erst verdoppeln musste, um sicher zu sein, dass es sich um den ersten Satz der Neunten handelte. Vielleicht werden ja Aufführungen, welche mit Beethovens Tempoangaben so verfahren wie Saint-Saëns mit dem Offenbachschen Cancan im "Carnaval des animaux", bald einmal ebenso exotisch wirken wie eine Schildkröte auf dem Pariser Boulevard. Wenn es soweit kommen sollte, dann wäre dies weitgehend das Verdienst jener vorwiegend englischen Ensembles, welche Beethoven-Symphonien auf den Instrumenten der Entstehungszeit und ohne Retuschen spielen und sich um Treue zum Notentext bemühen. Solcher "Original"-Fetischismus ist gewiss – wie zu zeigen sein wird – nicht unproblematisch; er hat aber zumindest den Vorteil, den originalen Metronomisierungen näherzukommen als philharmonische Aufführungen zwischen Wien, St. Gallen und New York; die wahrscheinlich seit Wagner, spätestens aber seit Furtwängler entstellten Charaktere von Beethovens Musik werden damit wenigstens teilweise restituiert.
Zwar haben schon früher Dirigenten wie Arturo Toscanini, Hermann Scherchen, René Leibowitz und Michael Gielen1 sich um die originalen Tempi bemüht, aber diese Bemühungen mussten ohne die Propaganda von Plattenkonzernen auskommen, die das Argument der "Authentizität" – welches einer erneuerten Spielweise von Barockmusik bereits einen Boom beschert hatte – nun für den Absatz von Beethoven-Platten einsetzen konnten. Die "Authentischen" sind ein beträchtlicher Faktor im Musikbetrieb geworden, und ihr Vorpreschen in der Musikgeschichte ist auch eine Eroberung von Anteilen des Schallplattenmarktes. Kein Wunder, dass es da Konjunkturritter gibt, die schnell und unsorgfältig ganze Packungen von Symphonien auf den Markt werfen. Dazu rechne ich vor allem die von Roy Goodman geleitete Hanover Band, die mit einer Gesamtaufnahme der Beethovenschen Symphonien2 hervorgetreten ist, die nicht nur orchestral unsorgfältig, sondern auch in den Tempi alles andere als authentisch ist. Auch Christopher Hogwood und die Academy of Ancient Music3 treffen die Tempi nicht immer; ob etwa das erheblich zu langsame Tempo des 1. Satzes der Eroica Konzept oder Schlamperei ist, ist schwer zu sagen. Angesichts der insgesamt wenig ausgefeilten Aufführung dieses Satzes der Eroica neige ich eher dazu, auch das langsame Tempo einem Aufnahmeprozedere zuzuschreiben, das aus Gründen der Rendite mit möglichst wenig Zeit auskommen muss. Während bei den herkömmlichen Symphonieorchestern die lange Tradition der Beschäftigung mit Beethoven-Symphonien zu abgestandenen Interpretationen führt, so hat die Frische, mit der auf alte Musik spezialisierte Ensembles die klassische Symphonik angehen, auch die Kehrseite einer Unausgereiftheit, die den Zwang spüren lässt, Werkzyklen integral und rasch auf den Markt zu bringen, um der Konkurrenz zuvorzukommen. Ganz geschafft haben es Hogwood und die Seinen dann doch nicht, den bereits früher gestarteten Roger Norrington mit seinen London Classical Players4 auf dem Beethoven-Parcours einzuholen; ganz zu schweigen von der Hanover Band, die aber wegen zu zahlreicher Fehler als disqualifiziert gelten muss. Mit ihr brauchen wir uns also nicht weiter zu beschäftigen. Für die kritische Würdigung der beiden andern Einspielungen möchte ich nun nicht ein Exempel wie das oben angedeutete der "Eroica" heranziehen, wo die Nichtberücksichtigung der Tempoangabe die Musik von vornherein auf eine falsche Bahn lenkt.
Paradoxerweise zeigt sich die Problematik der "Authentischen" nämlich gerade dort am schärfsten, wo die Interpreten kritiklos sich an die Metronomangabe halten, wenn Widersprüche zwischen verbaler Tempoangabe und Metronomisierung auftreten. In der 9. Symphonie, die als Beispiel dienen soll, gibt es dafür zwei eklatante Fälle: das Trio des Scherzos, ein Presto in Halbe = 116 und den "Alla-Marcia-Teil" im Finale, der mit punktierte Viertel = 84 metronomisiert ist, bei einer verbalen Tempoangabe von "Allegro assai vivace". Vor die Wahl zwischen Wort und Zahl gestellt, entscheiden sich beide Dirigenten für das scheinbar Exaktere: die Zahl. Das Trio wächst aus einer Steigerung des Scherzos hervor, die Norrington und Hogwood brechen müssen, um der Metronomisierung des Trios gerecht zu werden. Das wirkt aber nicht nur vom Formverlauf her unsinnig, es widerspricht auch der Vivace/Presto-Relation von Scherzo und Trio. Im Falle des Finales führt die Respektierung der "Alla Marcia"-Metronomisierung dazu, dass nach dem Fugato die Reprise des Freuden-Themas (T. 213ff.) gegenüber der Exposition im halben Tempo erscheint (oder erscheinen müsste, denn das halbe Tempo wäre so unsinnig langsam, dass sowohl Hogwood wie Norrington hier das Tempo etwas anziehen, auf punktierte Viertel = ca. 100 statt 84). Geht man von der Form dieses Finales aus, die grob als Introduktion und Rondo definiert werden kann, dann erscheint ein identisches Tempo für die Refrains logisch, d.h. dann müssten die 84 des Marcia-Teils für punktierte Halbe statt für punktierte Viertel gelten. Damit hätte man dann praktisch dasselbe Tempo wie bei der Exposition des Freudenthemas (Halbe = 80) und genau die gleiche Metronomisierung wie in der Doppelfuge von Freuden- und Millionenthema. Punktierte Halbe = 84 würde zugleich dem Charakter des Geschwindmarsches, den die Bezeichnung "Allegro assai vivace" suggeriert, entsprechen. Bezeichnend für ihren interpretatorischen Ansatz scheint mir nun, dass Norrington und Hogwood darauf verzichten, die Metronomangaben mittels solcher Überlegungen zu Form und Charakter zu problematisieren; sie nehmen die Zahlen als das Gegebene und suchen allenfalls – wie Norrington im Begleitheft – wenig überzeugende Begründungen, warum diese richtig sein sollen. Vermutungen, wie die fragwürdigen Metronomangaben zustande gekommen sein könnten, gibt es; sie können hier nicht ausgeführt werden.
Der Verzicht auf formanalytische Überlegungen zeigt sich auch im weitgehenden Verzicht auf Tempomodifikationen innerhalb eines Satzes. Beethoven schreibt äusserst selten solche Modifikationen vor; deshalb tendiert eine Ausführung, die sich an den Buchstaben hält, zum geradlinigen Festhalten des einmal eingeschlagenen Tempos. Nun ist Beethovens Musik in solchem Masse prozesshaft – und eben nicht motorisch –, dass ein starrer Puls ihr nicht gerecht werden kann. Ausserdem bedürfen die Beethovenschen Grossformen der Gliederung, der genauen Disposition von Übergängen, um erfassbar zu werden. Für die Prozesshaftigkeit von Beethovens Symphonik ist der Anfang der Neunten geradezu exemplarisch, indem das Thema nicht gesetzt, sondern quasi aus dem Nichts – aus den leeren Quinten heraus – sich allmählich bildet. Und geradezu exemplarisch verstösst Norrington gegen diese Formidee, indem er die Sextolen der Geigen so deutlich artikulieren lässt, dass statt einer Art von "Urnebel" ein 2/4-Takt erscheint, welcher der Schulregel entspricht, dass die Viertelschläge – der zweite etwas weniger als der erste – zu betonen seien. Ebenso geradlinig und unbeirrt taktieren Norrington und Hogwood den Übergang ins Seitenthema: die Verdichtung des aus dem Hauptthema stammenden Motivs mit den drei auftaktigen Sechzehnteln (T. 55ff.) wird agogisch nicht mitvollzogen, der dolce-Übergang nach B-Dur (T. 74ff.), der eine ganz neue Farbe in den Satz hineinbringt, hebt sich vom Vorhergehenden kaum ab, und im anschliessenden Seitenthema führt die Verdichtung der kontrapunktierenden Sechzehntel-Figuren (T. 84ff.) wiederum nicht zu einer Potenzierung der Intensität; es bleibt, bei Hogwood wie bei Norrington, bei einer Addition von Sechzehntelnoten – Information statt Interpretation sozusagen.
"Die Partitur so spielen, wie sie dasteht" – das ist explizit die Devise von Norrington, mit der er auch den Verzicht auf Retuschen und Verdoppelungen in Holz und Blech begründet. Im Gegensatz zu diesem positivistischen Textverständnis weist Clive Brown im Begleittext zur Hogwood-Aufnahme darauf hin, dass zweifache Bläser in den Wiener Orchestern jener Zeit nichts Ungewöhnliches waren und auch für die Uraufführung der Neunten verwendet wurden. Die bemerkenswert paradoxe Schlussfolgerung Browns, Hogwood verwende den bisher grössten Apparat für eine authentische Interpretation, zeigt die ganze Problematik des Begriffs Authentizität, oder vielmehr, dass dieser Begriff eher als Bezeichnung für ein Segment des Schallplattenmarktes denn als Kategorie musikalischer Interpretation taugt. Auch der Begriff der Retusche ist zu problematisieren. Michael Gielen hat darauf hingewiesen, dass selbst der unschuldigste Dreiklang am Klavier durch Betonung entweder der Oberstimme, des Basses oder der Mittelstimme "retuschiert" wird.5 Der Verzicht auf Retusche bei Hogwood und Norrington führt dazu, dass sie weitgehend die "natürlichen" Klangstärken wirken lassen. So verdeckt – um nur ein Beispiel zu nennen – das "authentisch" verdoppelte Blech bei Hogwood weitgehend die Imitationen der Geigen in T. 401 ff. des 1. Satzes, strukturell sicher die Hauptsache dieser Stelle. Der Verzicht auf Retusche, und sei es nur die der dynamischen Bezeichnung, geht also auf Kosten der strukturellen Deutlichkeit.
Richard Taruskin hat in einer an (Tempo-)Vergleichen und historisch-ästhetischen Betrachtungen reichen Besprechung der Norrington-Aufnahme6 den Verzicht auf Interpretation im hermeneutischen Sinne als Versuch gewertet, der Neunten zu widerstehen, die ideologischen und musikgeschichtlichen Gewichte, die sich an dieses Werk gehängt haben, abzuwerfen. Dieser trotz seines Plädoyers für Furtwängler sehr lesenswerte Aufsatz steht unter dem Titel "Resist the Ninth". Ich bezweifle allerdings, ob "resist", "widerstehen", im Zusammenhang mit Norrington (oder auch Hogwood – die beiden Aufführungen sind sich in mancher Hinsicht zum Verwechseln ähnlich) der richtige Begriff ist. Der Neunten widerstanden hat eher Michael Gielen, als er die historische Pervertierung von Beethovens und Schillers Utopie des "Alle Menschen werden Brüder" durch Zuspitzung des Hymnus zum Schreien hin und durch Kombination mit Schönbergs "Überlebendem aus Warschau" verdeutlichte. Bei den "Authentischen" sehe ich weniger einen Widerstand gegen die Neunte als eine Vergleichgültigung, eine Entwertung zum neutralen Kulturgut. Das ist zwar immer noch besser als ihre Inanspruchnahme für politische oder sportliche Zwecke (an abschreckenden Beispielen aus neuerer Zeit wären etwa Bernsteins Umtextierung von "Freude schöner Götterfunken" in "Freiheit schöner Götterfunke" anlässlich der Berliner Mauerfall-Feiern bzw. die Anheizung des Torjubels durch das Freudenthema beim 1. FC Köln zu nennen). Zu solcher Manipulation ist aber die Indifferenz Hogwoods und Norringtons nicht nur deswegen keine Alternative, weil sie mit dem Inhalt der Neunten nichts anzufangen weiss. Es ist Indifferenz auch dem strukturellen Sinn der Musik gegenüber. Dieser ergibt sich bei Beethoven weder aus dem Text der Partitur allein, noch gar aus der Applikation eines Regelsystems. Bei Musiken, die ihrerseits als Dutzendware nach Regelsystemen gefertigt sind, mag dies als Interpretationsgrundlage vollauf genügen. Die hochkomplexen Beethovenschen Partituren, zumal die der Neunten, verlangen indessen eine Interpretation, welche den Sinn, d.h. die Gestalt, den Gestus und die Funktion jeder Phrase, jedes Abschnitts, ja sogar jeder Stimme bedenkt und entsprechend realisiert. Dies macht oft Massnahmen nötig, die im Partiturtext nicht vorgesehen sind und die auch keinem Lehrbuch entnommen werden können. Die Willkür, mit der solche Massnahmen angewendet wurden und werden, hat wohl zum Boom "positivistisch" orientierter Interpretationen mit beigetragen. So verschieden die sog. authentische Interpretation gegenüber der traditionellen auch ist: sie teilt mit ihr die Fixierung auf ein Klangideal, dem sie die Deutlichkeit der Struktur unterordnet. Und manchmal trifft sie sich mit ihr in unreflektierten Traditionsrelikten, wie etwa am lakonischen Schluss des 1. Satzes, den sowohl Norrington und Hog-wood ritardieren, obwohl es weder in der Partitur steht noch irgendwelchen Sinn macht. Es entspricht nur der Gewohnheit, den Schluss eines Satzes mit einer Verlangsamung zu unterstreichen. Aber wer weiss, vielleicht steht diese Regel auch in einem Lehrbuch…
1Was die in diesem Artikel eingehender besprochene 9. Symphonie betrifft, gab es eine hinreissende Aufführung – bei der mehr als nur die Tempi stimmen – in Toscaninis New-Yorker Beethoven-Zyklus von 1939; sie ist auf einer CD des Labels Relief (CR 1893; Vertrieb in der Schweiz durch Sonimex) dokumentiert. Accord (Nr. 201002. CH-Vertrieb: Disques Office) hat vor kurzem die Neunte aus Scherchens Zyklus mit dem Orchestra della Radio Svizzera Italiana auf CD herausgebracht. Gielens Interpretation dieser Symphonie ist zusammen mit der Pastorale vom Südwestfunk auf 2 LP gepresst worden (SWF 123/24), die aber im Handel nicht erhältlich sind. Weiterhin auf dem Plattenmarkt erhältlich ist René Leibowitz' Zyklus mit dem Royal Philharmonic Orchestra London (Menuet 160 028-2 WJ, 5 CD, CH-Vertrieb: Sonimex).
2Nimbus Records 5144–48,5 CD.
3Ludwig van Beethoven: Symphonien Nr. 1–9; Academy of Ancient Music, Christopher Hogwood (Dir.); Editions de l'Oiseau-Lyre/Decca 425 696-2 (6 CD); Nr. 9 einzeln 425 517-2
4Ludwig van Beethoven: Symphonien Nr. 1–9; London Classical Players, Roger Norrington (Dir.); EMI 157-749852-1 (6 LP), EMI 653 749852-2 (6 CD); Nr. 9 einzeln 067 - 749 221-1 bzw. 567 -749 221-2
5Michael Gielen: "Die bessere Werktreue", Dissonanz Nr. 6, November 1985, S. 4ff.
6Richard Taruskin: "Resisting the Ninth", 19th Century Music vol. XII, Nr. 3, Frühling 1989, S. 241ff.
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.