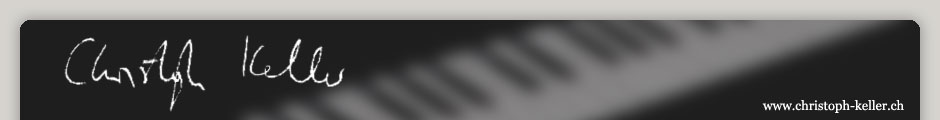Eine Oase für die Wiener Schule. Die Dirigenten Hermann Scherchen und Erich Schmid in Winterthur und Zürich
In einem Papier zu den Problemen der Orchestermusik im Radio, das Hermann Scherchen 1944 im Hinblick auf seine Berufung als Chefdirigent des Zürcher Studio-Orchesters von Radio Beromünster verfasste, heisst es: "Das Rundspruchorchester sollte prinzipiell keine Konzertaufführungen absolvieren, d.h. ausserhalb des Studios überhaupt nicht verwendet werden. Ausnahmen: es könnte während jeder Saison 2–4 hochbegabten Schweizer Kapellmeistern, die in ihren Städten über kein vollwertiges Orchester verfügen, zu rundspruchübertragenen öffentlichen Konzerten in deren Städten zur Verfügung stehen." Einer der drei Dirigenten, die Scherchen dabei erwähnt, ist "Erich Schmied(sic!)/Glarus".1
Erich Schmid war 1940 in Winterthur, wo Scherchen seit 1923 das Stadtorchester leitete, mit Weberns Passacaglia op. 1 und Brahms' Vierter Sinfonie aufgetreten, fristete im übrigen aber in Glarus als Musikdirektor – das hiess soviel wie: Leiter von Laienchören und -orchestern inkl. Blasmusik – ein Leben in einem geistigen Umfeld, das von jenem seiner Frankfurter und Berliner Studienzeit denkbar weit entfernt war. In Frankfurt verkehrte Schmid im Kreis von Adorno, Erich Itor Kahn, Mátyás Seiber und kam auch in Berührung mit Webern, ehe er 1930/31 als Kompositionsschüler von Schönberg für ein Jahr nach Berlin wechselte. Da für sein Weiterkommen, wie er im Herbst 1932 an Schönberg schrieb, die "Stellungsfrage" ernsthaft geworden sei, müsse er auch daran denken, eventuell anfangs des nächsten Jahres in die Schweiz zu ziehen, "obwohl ich diesen Entschluss nicht gerne fassen möchte".2 Im Sommer 1933 – die Nazis waren seit einem knappen halben Jahr an der Macht – war es dann soweit: "Meine Arbeit am Rundfunk (in Frankfurt)3 wurde im April dieses Jahres von heute auf morgen abgebrochen durch die politischen Verhältnisse. Meine Schweizer Nationalität spielte die ausschlaggebende Rolle. (…) So bleibt mir nichts anderes übrig, als in die Schweiz zu ziehen und zu sehen, dass ich mich dort durchsetzen kann."4 Dies schrieb Schmid am 20. Juli an Schönberg, der damals bereits seiner Professur an der Preussischen Akademie der Künste enthoben war und am 15. September auf diesen Brief mit einer Karte aus der Gironde reagierte, adressiert ans Evang. Pfarrhaus Balsthal. Dorthin, in sein Elternhaus, war Schmid nämlich nolens volens zurückgekehrt. Schmid erinnerte sich viel später,5 dass ihn seine Mutter auf ein Zeitungsinserat mit einer Stellenausschreibung in Glarus hingewiesen habe, und er damals nicht einmal gewusst habe, wo Glarus liege, sondern es mit St. Gallen verwechselt habe.
Wie Schönberg ihm geraten hatte, machte er es sich auch in Glarus zur Gewohnheit, täglich zu komponieren – vielmehr: zu "schreiben", denn es handelte sich nicht so sehr darum, Kompositionen zu erfinden, als handwerklich in Übung zu bleiben durch das Verfertigen von Fugen, Kanons u.ä. Freilich, zu dieser Zeit konnte Schmid bereits ein beachtliches Oeuvre vorweisen: Bis zu seinem Wechsel in die Schweiz hatte Schmid acht Werke komponiert – nach den Massstäben der Wiener Schule eine ganze Menge und im Falle Schmids immerhin die Hälfte seines schliesslichen kompositorischen Gesamtwerks. Seine Sonatine op. 1 für Klavier und Violine wurde 1930 in Anwesenheit Arnold Schönbergs in Frankfurt uraufgeführt;6 es war das Stück, mit dem sich der 23jährige dem zukünftigen Lehrer vorstellte. Mit demselben Werk präsentierte sich Schmid ein Jahr später den schweizerischen Tonkünstlern7 – und erntete Gelächter. Das äusserst knapp und prägnant formulierte, harmonisch zur Zwölftönigkeit tendierende viersätzige Werk muss auf die Tonkünstler, deren fortgeschrittenste damals gerade den Neoklassizismus Nadia Boulangers rezipiert hatten, während die meisten weiterhin spätromantische Klangbäder bevorzugten, wie ein rotes Tuch gewirkt haben. Der 80jährige Schmid äusserte sich im Rückblick: "Als ich dann (in die Schweiz) zurückkam, habe ich mein Streichquartett dem Tonkünstlerverein eingeschickt. Und das kam ohne Kommentar zurück. Gut, das kann passieren. Aber ich habe dann gehört, dass einer dieser Herren gesagt hat, solange er in diesem Vorstand sei, werde so etwas nicht aufgeführt. (…) Es war damals schon die Zeit, das muss man heute sehr eindeutig sagen, wo diese Art von Musik sehr verfemt gewesen ist."8 "Diese Art von Musik" – das hiess die der Wiener Schule, wobei im Falle von Schmid der Einfluss Weberns mindestens so gross war wie jener des Lehrers Schönberg. Die Aufführung von Weberns Orchesterstücken op. 10 in einem Konzert des Frankfurter Sinfonieorchesters unter Hermann Scherchen im Februar 1929 wurde für Schmid "zum entscheidenden Erlebnis im Hinblick auf Weberns Musik. Ich war einfach betroffen von dieser für mich neuen Klangwelt. Dieser Reichtum an Nuancierungen der Instrumentalfarben innerhalb knappster Formulierung melodischer und harmonischer Geschehnisse – wirklich, da fühlte ich Luft von anderen Planeten. (…) Ich muss bekennen, dass mich lange Zeit diese sublime musikalische Ausdruckswelt mehr und direkter ansprach als Schönbergs oder Bergs Musiksprache."9 An René Leibowitz schrieb Schmid 1938, er "liebe die Musik dieses Meisters über alles". Ein Schlüsselerlebnis war für ihn auch Weberns Auftritt als Dirigent in Frankfurt mit Mozarts g-Moll-Sinfonie und Schuberts Unvollendeter. "Da stand dieser kleine, aber sehnige Mann, fern jeglichen Starkults, mit beschwörenden Gesten den musikalischen Ablauf führend – ein Mozart bar jeglicher Weichlichkeit, ohne Sentimentalität, doch mit bezwingender Intensität. (Bei Schubert) erinnere ich mich vor allem an jene Überleitungstakte zum 2. Thema im 1. Satz: nicht das übliche Ritardando, aber eine Nuance der Entspannung wurde hier erreicht, aus welcher dann der herrliche Gesang der Celli aufblühen konnte. Nie zuvor habe ich das so vernommen."10 Die Entwicklung des späteren Webern hat Schmid Stück um Stück mitverfolgt. "Auch für uns waren natürlich die Entwicklungen bei Webern in vieler Hinsicht neu und überraschend. Mit Spannung erwarteten wir deshalb jede Neuerscheinung eines Webernschen Werks. (…) Dass Webern eine Sinfonie komponiert hat, galt für uns damals als etwas fast Undenkbares. Der Blick in die Partitur des 1. Satzes liess uns daran zweifeln, und man fragte sich wirklich, was ist das. Ein Notenbild, wie man es bis anhin nicht kannte. Es sieht aus wie ein abstraktes Bild, Überlagerungen von weit auseinander gezogenen Linien, die – aufgeteilt auf verhältnismässig wenige Instrumente – ein Klangspektrum von scheinbar unzusammenhängenden Motivgebilden vor uns ausbreiten. Also doch wieder etwas ganz Neues. Zum ersten Mal hörte ich dieses Werk im Winter 1930 in Berlin, und es wirkte auf mich verwirrend. Der Umstand, dass dieser 1. Satz genau um die Hälfte zu langsam gespielt wurde und dadurch jeglichen Zusammenhang verlor, mag allerdings mitverantwortlich gewesen sein. Nun: beide Werke, die Sinfonie und das Streichtrio, als Exponenten des neuen Stils, stiessen damals zum Teil auf schärfste Ablehnung bei Hörern und Kritik."11 Webern gab Schmid brieflich ausführliche Auskünfte zu seinem "neuen Stil", wobei er sich die von Schmid offenbar gewünschte neue Terminologie allerdings verbat und sich dagegen verwahrte, die "bei den Meistern erkannten Gesetzmässigkeiten" umstürzen zu wollen.12
Nicht verwunderlich also, dass Webern, der so grossen Wert auf die Verankerung seines Schaffens in der Tradition legte, das Programm von Schmids Winterthurer Konzert lobte, welches seine Passacaglia zu jener des Schlusssatzes von Brahms' Vierter in Bezug setzte: "Es ist mir auch sehr lieb, dass Sie mein Stück ausschliesslich mit 'klassischen' Werken zusammen machen. Das ist auch Schule Schönberg! Sehr gut!"13 Webern weist auf mehrere Fehler in der Partitur hin und gibt Anweisungen zur Tempogestaltung; die an den "Herrn Musikdirektor Erich Schmid, Glarus" adressierte Karte schliesst mit den Worten: "Nun, ich bin ja überzeugt, dass Sie alles richtig empfinden! Und möchte wirklich gern dabei sein. Hoffentlich gelingt's mir. Der Postverkehr braucht lange Zeit! Bitte damit zu rechnen u. mir Einladung u.s.w. ehestens zukommen zu lassen; sonst könnte es für mich auf den Passämtern zu spät werden! Ich freue mich, Sie kennen zu lernen und bin mit den herzlichsten Grüssen Ihr Anton Webern". Das Dabeisein gelang ihm; er wohnte nicht nur allen Orchesterproben für das Winterthurer Konzert am 7. Februar 1940 bei, sondern arbeitete ausserdem mit Schmid (als Pianisten) und der Sopranistin Margrit Gradmann-Lüscher an den George-Liedern op. 4 und Liedern aus op. 12 im Hinblick auf ein Konzert bei der IGNM Basel, welches drei Tage später stattfand. Mit der Aufführung der Passacaglia scheint Webern zufrieden gewesen zu sein, schrieb er doch an Schmid: "Meine Freude über Ihre Aufführung meiner Passacaglia u. Ihre Dirigentenleistung überhaupt, sowie insbesonders auch über unser persönliches Zusammentreffen war ja so gross, dass ich mich immer wieder an diese wirklich so durchaus freundlichen u. durch nichts, aber schon rein gar nichts getrübten Tage in Winterthur von Herzen gern erinnere! (…) Auch ich hatte sehr erwartet, dass Sie nach Ihrem so schönen Erfolg in Winterthur nun doch schon für diesen Winter erweiterten Wirkungskreis (z. Bspl.: neuerdings ein Konzert in Winterthur) würden finden können. Aber das wird ja alles bestimmt kommen. Ich bin dessen ganz sicher. Ihre neuen Arbeiten würde ich gern kennen lernen. Aber jetzt kann man es nicht riskieren, Manuscripte zu schicken. Sicher kommt auch in dieser Hinsicht bald Ihre Zeit. Sie kennen ja meine Überzeugung, dass sich der natürliche Gang nicht aufhalten lässt u. dass er bei uns zu finden ist, d.h. unserer Musik."14
Was das Schaffen in der Isolation betrifft, befanden sich also Schmid und Webern in den Kriegsjahren in einer ähnlichen Situation. Die für den Schönberg-Kreis charakteristische Überzeugung von der eigenen geschichtlichen Mission wirkte, bei Webern wohl stärker als bei Schmid, als Stimulans in dieser – wie Webern es nannte – "schweren Zeit"15. Zuspruch erhielt Schmid auch von René Leibowitz, der – vermittelt durch den gemeinsamen Freund Erich Itor Kahn – mit Schmid 1938 in brieflichen Kontakt getreten war: "Es muss wirklich furchtbar sein, mit keinem Menschen über seine eigenen Kompositionen sprechen, ja nicht einmal allgemeine Ideen austauschen zu können. Man fühlt sich schon in Paris ziemlich einsam und wenn es nicht glücklicherweise ein paar Leute wie Erich Kahn gäbe, ja ich weiss wirklich nicht, was man da anfangen könnte. (…) Die Gewissheit, musikalisch einer höheren und guten Lehre zu gehorchen, wie es unser Fall ist, gibt uns doch viel Zuversicht."16 In der Vorliebe für Webern, bei dem Leibowitz studiert haben wollte,17 waren sich die Korrespondenzpartner18 einig, wie Leibowitz in diesem Brief bestätigt: "Es freut mich, dass Sie Webern so gerne mögen. Ich halte ihn auch für einen der grössten Komponisten unserer Zeit."
Dennoch: Auf die Dauer hielt Schmid das Komponieren in der Isolation, ohne Aufträge und Aufführungen, nicht durch; mit den Bagatellen für Klavier op. 14 schrieb er 1943 für lange Zeit sein letztes Werk; nur ein kleines Trio, geschrieben für seine drei Kinder, folgte 1955 noch nach. Ganz anders Webern. Im oben zitierten Brief berichtete er Schmid, er sei "pausenlos an der Arbeit. Fertig geworden sind 'Variationen' für Orchester. Die 'Kantate', nach der Sie fragen, ist schon längst beendet. Eine Kopie der Partitur ist derzeit sogar in der Schweiz! Herr Sacher hatte darum angefragt u. die Universal-E. schickte sie ihm daraufhin."19 Im Gegensatz zu Schmid, der nach der Abweisung durch den Tonkünstlerverein dort nie mehr etwas einschickte und sich auch nie um Publikationen seiner Werke bemühte (die erste Edition eines seiner Werke, der Bagatellen op. 14, erfolgte im Jahre 1991!), war Webern stets in eigener Sache aktiv. So bemühte er sich, über den nach Basel emigrierten Willi Reich einen Kompositionsauftrag von Paul Sacher zu erhalten. Sacher, der für die Wiener Schule erst Interesse zeigte, als zweifelsfrei feststand, dass sie aus der Musikgeschichte des 20. Jahrhunderts nicht wegzudenken war, erteilte ihm aber eine Absage, so dass Webern gezwungen war, durch das Verfertigen von Klavierauszügen seinen – äusserst bescheidenen – Lebensunterhalt zu verdienen. Auf Sacher bzw. Othmar Schoecks Oper "Das Schloss Dürande" bezieht sich die Bemerkung im Brief an Willi Reich vom 23. August 1941:
"Ich muss mich zur Zeit übrigens wieder mit einem Auszug schinden, von einer Oper – bitte, es nicht weiter sagen – eines Schweizer 'Meisters'. Wehe Ihnen, wenn Sie es verraten! (Wenn andere Schweizer ein Einsehen gehabt hätten, müsste ich es vielleicht nicht machen)".20 Erst zehn Jahre nach Weberns Tod, als die Dominanz des Neoklassizismus auch in der Schweiz allmählich nachzulassen begann, kam es bei Sachers Basler Kammerorchester zur ersten Aufführung eines Werks von Webern: am 1. April 1955 dirigierte Hans Rosbaud dort die Sinfonie op. 21.
So erlebten die Variationen für Orchester op. 30, für die weder Sacher noch Ansermet21 Interesse zeigten, ihre Uraufführung in einer andern Schweizer Stadt, in Winterthur (im Deutschen Reich durften die Werke Webern als die eines "Judenknechts" nicht gespielt werden – da halfen weder Weberns private Sympathien für das Naziregime noch die Nazis in seiner Familie). Gewidmet sind sie dem Winterthurer Mäzen Werner Reinhart, nicht weil dieser den Auftrag erteilt hätte, sondern aus Dankbarkeit für die erneute Einladung nach Winterthur anlässlich der Uraufführung dieses Werks (Reinhart, der Othmar Schoeck sehr grosszügig und über lange Zeit unterstützte, scheint dafür bei dem Klavierauszugs-Auftrag für "Das Schloss Dürande" die Hand im Spiel gehabt zu haben)22
Hermann Scherchen, den Webern laut Karl Amadeus Hartmann für den besten Dirigenten seiner Werke hielt,23 leitete die Uraufführung im 13. Hausabend24 des Winterthurer Stadtorchesters am 3. März 1943, der ausserdem die Uraufführung des "Symphonischen Rondos auf alte Schweizerlieder" von Hans Studer sowie Werke von Conrad Beck, J.H. Albrechtsberger und Schubert brachte. Schon dieses Programm zeigt, dass Winterthur keineswegs eine Hochburg der Neuen Wiener Schule war,25 obwohl mit Hermann Scherchen dort während fast drei Jahrzehnten ein Dirigent wirkte, dessen Debüt auf der Uraufführungstournée von Schönbergs Pierrot lunaire erfolgte und der im Jahre 1913 die Berliner Erstaufführung der 1. Kammersymphonie nicht nur leitete, sondern auch selbst veranstaltete. So stiess auch Schmids Vorschlag, die (notabene vollkommen tonale) Passacaglia op. 1 zu dirigieren, auf Widerstände: Schmid sollte erst dem Vorstand des Musikkollegiums das Werk vorspielen, was dann einzig wegen des Kriegsausbruchs unterblieb.26 Zu stark war der Druck zur Förderung des einheimischen Schaffens, und innerhalb diesem die Bevorzugung des neoklassizistischen Mainstreams, in dieser Epoche der "geistigen Landesverteidigung". Der Chronist des Musikkollegiums Winterthur sprach im Rückblick auf Scherchens Wirken denn auch von einem "perennierenden eidgenössischen Tonkünstlerfest";27 den Schweizerischen Tonkünstlerverein und den Schweizerischen Berufsdirigenten-Verband hinderte dies allerdings nicht daran, 1944 gegen Scherchens Berufung ans Studio-Orchester von Radio Beromünster eine auf Ausländerfeindlichkeit gestützte Kampagne in Gang zu setzen.28 Diese blieb zwar zunächst erfolglos, dürfte aber bei Scherchens Entfernung aus allen Schweizer Positionen im Jahre 1950 nachgewirkt haben.
Obwohl das Winterthurer Publikum also mit Weberns "neuem Stil" so wenig vertraut war wie irgend ein anderes, fand die Uraufführung der Variationen eine "wider alle Erwartung geradezu hocherfreuliche" Aufnahme.29 Schmid erinnerte sich 1983: "Dass die Aufführung zu keinem Skandal ausartete, dass das Publikum die Variationen ruhig anhörte, beeindruckte Webern sehr. Er meinte: 'Schauen Sie, lieber Schmid, nun glaube ich doch, dass meine Musik allmählich verstanden wird.' (…) Die Aufführung der Variationen war für uns natürlich ein besonderes Ereignis, handelte es sich doch um das erste Orchesterwerk in dem nun gefestigten neuen Stil. Aber auch für Webern selbst muss die Möglichkeit des Hörens ganz besonders wichtig gewesen sein. Das bezeugen verschiedene Äusserungen seinerseits. 'Dass ich mein Stück habe hören können, war mir sehr recht, denn es war mir sehr darum zu tun, selbst zu kontrollieren, was es aufweist. Ich glaube Recht bekommen zu haben, nämlich dass aufgrund solcher Art des Zusammenhangs auch der aufgelösteste Klang völlig geschlossen wirken muss und daher in puncto Fasslichkeit kaum ein Wunsch offen sein dürfte.'"30 Die Aufführung durch Scherchen qualifizierte Webern als "recht gut".31 Scherchen, wiewohl ein früher Promotor Weberns, stand dessen Werk keineswegs unkritisch gegenüber. Er, der bei Mahler bekanntlich ganze Sätze zusammenstrich, scheint bei Webern umgekehrt die Kürze moniert zu haben, wie einem Brief Weberns zu entnehmen ist: "Ihrem Einwand gegen die knappe Kürze meiner Musik möchte ich entgegenhalten: Werden nicht grade durch solche Knappheit der Darstellung die 'sinnlichen, tragenden Kräfte' der Musik erst recht wirksam, ähnlich wie die der Sprache in einem lyrischen Gedicht?"32 Auf diesen Brief hat Scherchen eine (schwer lesbare) Entgegnung skizziert, die erkennen lässt, dass er den Vergleich mit dem lyrischen Gedicht für unangemessen hält, und der Ansicht ist, der Musik würde durch die aus dem Aphoristischen folgende Überintensivierung eine unerfüllbare Aufgabe zugewiesen. Die Kritik Scherchens mochte sich auf in der Tat aphoristische Kompositionen wie die Orchesterstücke op. 10 bezogen haben. Demgegenüber bilden die Variationen op. 30 einen an Entwicklungen reichen Sonatensatz in sogenannter "Adagio"-Form, d.h. mit einer in die Reprise eingelassenen Durchführung (statt einer Durchführung als eigenem Formteil), sind also in dieser Hinsicht dem 1. Satz des Streichquartetts op. 2833 verwandt. Webern sprach unter Bezug auf Beethovens "Geschöpfe des Prometheus" und die "Tragische" von Brahms (die ebensolche verkürzten Sonatensätze sind) von einer "Ouverture";34 zu dieser Bezeichnung mag ihn auch die dem Hauptsatz vorangehende Einleitung, die in Ouvertüren zwar nicht zwingend, aber doch häufig ist, veranlasst haben. Dass innerhalb der Reprise die Einleitung wieder aufgegriffen wird (sie wird als 5. Variation mit der Reprise der Überleitung synthetisiert) kann ebenfalls als Anspielung an eine Ouvertürentradition gesehen werden; man denke etwa an die Reminiszenz der Einleitung in Mozarts "Così fan tutte"-Ouvertüre. Das "Thema" der Variationen, eine in drei Viertongruppen unterteilte Reihe, wird allerdings gleich zu Beginn (durch Kontrabass, Oboe und Posaune) exponiert – insofern ist der Begriff Einleitung missverständlich (er bezieht sich nur auf die den Variationenzyklus überlagernde "Adagio"-Form). Trotz ihrer kurzen Dauer – Webern meinte, sie dauerten "so circa eine Viertelstunde",35 die 1956 erschienene Partitur gibt 9 1/2 Min. an, die meisten Aufnahmen haben aber eine Dauer von bloss 7–9 Min. – sind die Variationen op. 30 also keineswegs ein aphoristisches Werk und können insofern auch als eine kompositorische Antwort auf Scherchens Kritik gesehen werden.
Scherchen scheint im Falle von Weberns op. 30 ganz der getreue Korrepetitor gewesen zu sein, obwohl das Autograph, das ihm bei der Uraufführung als Dirigierpartitur diente, auf den ersten Blick nicht danach aussieht: Mit wilder Energie und grobem Stift hat er da dem kalligraphisch ausgefeilten Notenbild Weberns zugesetzt, mit roten, blauen und violetten Farben Takt- und Tempowechsel verdeutlicht, Schlagunterteilungen eingetragen, Einsätze einzelner Instrumente markiert, Pausen eingekreist usw. Bemerkenswert ist die Redundanz seiner Eintragungen; so ist etwa die Taktart, mit der eine Seite beginnt, meistens gleich mehrfach mit grossen Chiffren signalisiert: nicht nur am rechten Rand der vorhergehenden sowie am linken Rand der betreffenden Seite, sondern auch noch am Taktanfang und quer durch die Register. Die ungewöhnlich häufigen, oft taktweisen Wechsel des Metrums scheinen also selbst für einen in neuer Musik so erfahrenen Dirigenten wie Scherchen eine Herausforderung gewesen zu sein. Dass die Metronomzahl ausschliesslich zwischen 160 und 11236 wechselt, könnte als Ausgleich dieser Schwierigkeit gedacht sein; musikalisch ist es nicht zwingend, werden doch die verschiedenartigsten Charaktere dadurch mit einiger Willkür auf zwei Werte reduziert, und es scheint ursprünglich von Webern auch nicht so vorgesehen gewesen zu sein: Während die ganze Partitur mit Tinte geschrieben ist, sind die Metronomzahlen (nicht aber das dazugehörige Notenlängensymbol mit Gleichheitszeichen und "ca.") fast durchwegs mit Bleistift eingetragen, wobei sehr häufig Rasurspuren zu bemerken sind. Es ist also zu vermuten, dass ursprünglich eine differenziertere Tempostruktur vorgesehen war. Nicht auszuschliessen ist, dass Webern, der auf Scherchen angewiesen war – er war der einzige, der das Werk schliesslich zur Aufführung annahm – und sich in einer Position der Schwäche befand, hier einem Wink des praktisch erprobten Kapellmeisters folgte.37 Scherchens Eintragungen lassen aber keinerlei Eingriffe in die Komposition erkennen: Meist beschränken sie sich auf die Hervorhebung von bereits in der Partitur Notiertem oder dann handelt es sich um Einrichtung für die Praxis durch Einfügen von Stricharten und Bindebogen oder das Ausschreiben von Staccato-Punkten mittels Verkürzung der betreffenden Notenwerte. Einzig die Bemerkung "voran" findet sich an einigen Stellen, wo der Komponist keine Beschleunigung vorgesehen hatte (T. 72, 88, 103).
Geradezu ordentlich im Vergleich zum Autograph nehmen sich die beiden Handexemplare der gedruckten Partitur aus, die im Hermann Scherchen-Archiv der Akademie der Künste in Berlin aufbewahrt sind: Da die Taktarten bereits in grossen Chiffren dreifach gedruckt sind, begnügte sich der Dirigent damit, deren Wechsel mit vertikalen, Accelerandi und Ritardandi mit horizontalen Pfeilen zu signalisieren und ausserdem die Metronomzahlen 112 bzw. 160 mit rotem Farbstift zu verdeutlichen. Wo sich kreuzende Reihen identische Tonhöhen ergeben, hat Scherchen Verbindungslinien gezogen, vermutlich um auf die Abstimmung der Intonation aufmerksam zu machen. Während dem Autograph keine analytischen Hinweise beigefügt sind, hat Scherchen in der Druckausgabe die akkordischen Zusammenklänge nach Typen geordnet, genauer: einem der beiden allgegenwärtigen Typen zugeordnet. Da fast alle Akkorde in diesem Werk aus einer der drei Viertongruppen der Reihe gebildet sind, und die Reihe, deren Töne 7–12 die transponierte Krebsumkehrung von 1–6 sind, so angelegt ist, dass die erste und die dritte Gruppe identische Akkordaggregate ergeben, erscheinen nämlich zwei stets wiederkehrende Akkordstrukturen (umso auffälliger die beiden aus horizontalen Reihenverläufen resultierenden Blechbläserakkorde, die den Beginn der Variation 6 bzw. Coda markieren – Indiz für Weberns traditionsbewusstes Musikdenken, das die formbildende Funktion der Harmonik von der funktionalen Tonalität in die Zwölftönigkeit verpflanzen wollte). Eine Analyse der Reihenstruktur ist den beiden Scherchenschen Handexemplaren der gedruckten Partitur zwar nicht zu entnehmen; immerhin finden sich gelegentlich Angaben zur Reihenstruktur, etwa ein rückwärts gerichteter, gebogener Pfeil als Symbol für den Krebs.38
Die im Scherchen-Archiv aufbewahrte Aufnahme von diesem Werk39 zeigt allerdings, dass hinsichtlich der Tempi Scherchen sich nur zum Teil an die Partiturangaben bzw. an seine eigenen ostentativen Eintragungen gehalten hat: Die mit 112 metronomisierten Abschnitte sind nämlich fast durchwegs markant langsamer genommen, meistens im Bereich von 60–70 pro Zähleinheit. Dagegen entsprechen die schnellen Abschnitte einigermassen Weberns Metronomisierung mit 160. Möglicherweise hat Scherchen durch die Pointierung des Gegensatzes das Stück wirkungsvoller und damit leichter zugänglich machen wollen. In seinen Aufführungen in Darmstadt und München waren die Gegensätze noch zugespitzter, die "langsamen" Abschnitte noch gedehnter (in Darmstadt – ausgerechnet! – bis ins Extrem), die schnellen noch zupackender und wilder. Die verbalen Anweisungen "sehr ruhig" bzw. "lebhaft, sehr bewegt" etwa in Variation 1 (T. 20–55) scheinen freilich eine solche Pointierung sogar nahezulegen. Dass Webern selbst hinsichtlich der Metronomisierung zumindest unsicher war, zeigt ja eben die Tatsache, dass er die Zahlen bloss mit Bleistift eingetragen hat, sie also für eine nachträgliche Änderung offen gehalten hat. Weitere Aufführungen der Variationen zu Weberns Lebzeiten fanden nicht mehr statt, und zur Drucklegung kam es erst elf Jahre nach seinem Tod, was das Ausbleiben solcher Änderungen erklären mag.
Auch von Erich Schmid existiert eine Aufnahme der Variationen; sie entstand 1964 mit dem Radio-Orchester Beromünster, dessen Leitung Schmid nach achtjähriger Tätigkeit beim Tonhalle-Orchester Zürich im Jahre 1957 übernommen hatte.40 Auch Schmid, obwohl nicht der Dirigent der Uraufführung, kann für sich eine Webern-Interpretation aus erster Hand in Anspruch nehmen. Seine Handhabung des Tempos folgt allerdings ebenso wenig dem Buchstaben (bzw. den Zahlen) der Partitur wie jene Scherchens. Anders als dieser hat er zwar das Verhältnis der beiden Tempoebenen zueinander weitgehend respektiert, aber dafür beide Tempi erheblich gesenkt. Nur wo der (Scherzando-)Charakter dies nahelegt und die Komplexität vergleichsweise gering ist, wie in der 2. und 3. Variation, erreicht Schmid Tempo 160. Er handhabt das von Webern in der Partitur notierte und von Scherchen auf seine Weise realisierte Zwei-Tempo-Raster sehr flexibel und kann so die thematisch-motivische Struktur zu optimaler Verständlichkeit bringen. Fasslichkeit war ihm oberstes Gebot. Dank einer sehr sorgfältigen Phrasierung, die auch über Pausen hinweg einen Zusammenhang herstellt statt diesen in einzelne Punkte aufzulösen, erreicht er, dass auch das Aufgelösteste geschlossen erscheint, entsprechend dem von ihm berichteten Ausspruch Weberns (s.o.). Und die Abstufung der Stimmen je nach ihrer Wichtigkeit ermöglicht die Durchhörbarkeit des polyphonen Gebildes. Zwar hat Webern nicht wie Schönberg Haupt- und Nebenstimmen in der Partitur bezeichnet, aber dass auch bei ihm diese Kategorien noch Gültigkeit haben, dürfte ausser Zweifel stehen. So ist z.B. evident, dass in T. 2 die Oboe als Trägerin des Themas gegenüber der kontrapunktierenden Viola hervortreten muss, auch wenn beide Parts mit forte bezeichnet sind.
Dafür wie auch für die an klassischen Modellen orientierte Gestik hatte Schmid, der Webern und überhaupt die Wiener Schule aus der Traditionsgebundenheit heraus verstand, einen wachen Sinn. Der Serialismus blieb ihm dagegen fremd; Werke der Darmstädter Schule hat er keine aufgeführt, und die Interpretation von Werken der Wiener Schule durch Exponenten des Serialismus wie etwa Boulez hielt er für ein Missverständnis.41 Hermann Scherchen dagegen war auch gegenüber der jüngsten Generation aufgeschlossen, leitete in den 50er Jahren Uraufführungen von Werken Stockhausens, Nonos und Xenakis – allerdings nicht in der Schweiz, wo er zu dieser Zeit als Dirigent so wenig erwünscht war wie die Musik der genannten Komponisten. Das elektro-akustische Experimentalstudio, das er seit 1954 an seinem Tessiner Wohnort Gravesano betrieb, ist ein weiterer Beleg für sein emphatisch dem Neuen verpflichtetes Denken und Handeln. Scherchen war sozusagen ein Progressiver aus Prinzip; sein Plädoyer für die im Entstehen begriffenen sozialistischen Staaten der Nachkriegszeit, welches den Anlass zu der Kampagne gab, die schliesslich zu seinem Rauswurf aus allen Schweizer Positionen führte,42 dürfte eher aus seiner teleologischen Weltsicht zu erklären sein als aus einer Übereinstimmung mit den Positionen der kommunistischen Parteien im einzelnen. Anders als etwa der ebenfalls dem Schönberg-Kreis entstammende Hanns Eisler teilte er nicht die ästhetischen Positionen, die im Prager Manifest von 1948 formuliert waren.43 Dem Postulat einer Kunst für das Volk hielt er entgegen, dass kein erstrangiger Komponist je zu einer "natürlicheren", bequemer verständlichen Ausdrucksweise zurückgekehrt sei. Die marxistische Konzeption von Kunst als "Überbau", der die Gesellschaft widerspiegelt, reinterpretierte er im Sinne der künstlerischen Avantgarde: Die Gesellschaft sei ein Werdendes, das über gewissen Grundlagen immer feinere, neue Organe entwickle, deren Vorkämpfer eben die "wahrhaften Künstler" seien – paradigmatisch standen ihm dafür der Bach der "Kunst der Fuge", der Beethoven der "Grossen Fuge" und der Verdi der "Pezzi sacri". Dem Mailänder Zwölftonkongress vom 5. Mai 1949 warf er vor, sich mit seiner "Kompromiss-Tüchtigkeit" selbst überflüssig gemacht zu haben; sein Bericht über diesen Anlass endet mit dem Satz: "Die Welt geht vorwärts und der Geist triumphiert"44 – eine Devise, die Scherchens Wirken bis hinein in seine Dirigierweise geprägt hat. Nirgends ist dies besser spürbar als in seinen Beethoven-Interpretationen, zumal in der Gesamtaufführung der Sinfonien, die er 1965 mit dem Orchestra della Svizzera Italiana in Lugano realisierte.45 Noch mit 74 Jahren hiess seine Devise "vorwärts" und trieb er das Orchester mit ungeheurer Energie und Kraft an – gelegentlich auch mit Rufen im Konzert! Dem Feierlichkeitskult, mit dem die deutsche romantische Schule den politisch engagierten Komponisten entstellt hatte, rückte er mit der Restitution der originalen Notentexte und insbesondere mit den authentischen Metronomzahlen zu Leibe. Wer wollte – oder das Glück hatte –, konnte schon damals einen Beethoven in raschen Tempi und ungeschönter Klanglichkeit erleben und brauchte nicht auf die selbsternannten Entdecker einer "authentischen Aufführungspraxis" zu warten, um eine Alternative zum Wirtschaftswunder-Beethoven eines Karajan zu haben.
Dass sie Zukunftsträchtiges machten, ohne dass es zu grosser Resonanz kam, darin kann man eine Konstante von Scherchens und Schmids Wirken in der Schweiz sehen: So wie Erich Schmid in den 60er Jahren erstaunt fragte, wer wohl vor zwanzig Jahren daran gedachte hätte, dass Webern, dieser ganz in sich gekehrte und hoffnungslos abseitige Komponist, zum Vorbild und Nährboden einer späteren Avantgarde würde,46 so würde Hermann Scherchen heute vielleicht sich die Augen reiben (oder die Ohren spitzen), wenn er hörte, dass ein alles andere als progressiver Dirigent wie David Zinman einen Beethoven-Zyklus in originalen Tempi auf den Plattenmarkt bringt und mit dem Etikett "erste Gesamtaufnahme mit modernen Instrumenten nach der neuen Bärenreiter-Ausgabe" erst noch einen Bestseller landet. Weder Scherchen noch Schmid konnten in der kulturell konservativen Schweiz ihre Potentiale ausschöpfen; allzu sehr mussten sie einheimisches Schaffen pflegen, das hinter den Standards der Schönberg-Schule, die sie mitbrachten, in den meisten Fällen weit zurück blieb. Dass der Schwerpunkt ihres Wirkens in der Schweiz lag, war allerdings nicht so sehr eine freie Entscheidung als eine Folge der Machtübernahme der Nazis in Deutschland. Immerhin, soviel kann zum Guten der Schweiz gesagt werden: Was andernorts als "Kulturbolschewismus" verboten war, durfte hier ein randständiges Dasein fristen.
Im übrigen aber galt das Motto "perennierendes Tonkünstlerfest" – auch beim Radio-Orchester Beromünster: Von den über dreissig Uraufführungen, die Scherchen dort zwischen 1945 und 1950 leitete, betrafen mehr als zwei Drittel Schweizer Komponisten von Joseph Lauber bis Armin Schibler; dazu kamen noch ca. siebzig weitere Exempel einheimischen Schaffens.47 Wenngleich nicht alle dieser Werke heute zu Recht vergessen sind, muss man doch sagen, dass die interessantere Zeit bei Scherchen begann, nachdem er die Schweiz (als Dirigent) verlassen hatte. Erich Schmid als indirekter Nachfolger Scherchens beim Radio-Orchester Beromünster knüpfte an dessen Tätigkeit an. Er war spätestens seit seiner Doppelexistenz als Blasmusikdirigent und Zwölftonkomponist im Glarnerland ganz andere Diskrepanzen gewohnt als die zwischen Anton Webern und Robert Blum. Sich mit den gegebenen Verhältnissen zu arrangieren war ihm so selbstverständlich geworden, dass er sich im Rückblick guten Gewissens als "Alleinherrscher" bezeichnen konnte, der am Radio selbst bestimmen konnte, was er dirigieren wollte. Die Faszination sei für ihn das Dirigieren gewesen, sagte Schmid auf die Frage, warum er mit Komponieren aufgehört habe.48 Das mag auf Scherchen, der das Komponieren noch früher als Schmid einstellte,49 ebenfalls zutreffen: Der als solcher faszinierende Dirigierakt kann sich jede Partitur zum Gegenstand machen. Es braucht glückliche Umstände, dass dabei etwas herausspringt, was für die Kunst von Belang ist.
1 Typoskript, Hermann Scherchen-Archiv der Akademie der Künste Berlin (AdK); abgedruckt in: Hansjörg Pauli/Dagmar Wünsche (Hg.): "Hermann Scherchen. Musiker. 1891–1966", Berlin 1986, S. 74ff.
2 Brief (Entwurf) vom 28. Oktober 1932, Erich Schmid-Nachlass der Musikabteilung der Zentralbibliothek Zürich (ZB). Schmid antwortete mit diesem Brief (abschlägig) auf Schönbergs Anfrage, ob er erneut für Studien nach Berlin kommen wolle.
3 Schmid war dort Assistent von Hans Rosbaud, dem Leiter der Musikabteilung und 1. Kapellmeister des Rundfunkorchesters.
4 Brief (Entwurf) vom 20. Juli 1933, Erich Schmid-Nachlass der ZB.
5 In einem Gespräch, das der Autor mit Schmid im Dezember 1986 für eine Radiosendung führte ("Zwei Zwöltonkomponisten in der Schweiz. Eine Sendung zum 80. Geburtstag von Alfred Keller und Erich Schmid", Schweizer Radio DRS2, 7. Januar 1987)
6 Schönberg weilte aus Anlass der Uraufführung des Operneinakters "Von heute auf morgen" in Frankfurt (man beachte die Anspielung auf diesen Titel im oben zitierten Brief Schmids vom 20. Juli 1933); die Premiere fand am 1. Februar 1930 statt, das Konzert mit Schmids Sonatine am 30. Januar.
7 Schweizerisches Tonkünstlerfest in Solothurn, 4. Mai 1931
8 s. Anm. 5
9 "Begegnungen mit Anton Webern und seiner Musik. Ein Bericht von Erich Schmid", Schweizer Radio DRS2, November 1983.
10 s. Anm. 9
11 s. Anm. 9
12 Brief vom 13. September 1941, Erich Schmid-Nachlass der ZB. Auf diesen Brief dürfte sich Weberns Bemerkung im Brief an Willi Reich vom 31. Juli 1942 beziehen, er hätte Schmid seinerzeit recht ausführlich auf verschiedene Fragen geantwortet und unbegreiflicherweise sei nichts mehr zurück gekommen. Der vorangegangene Brief Schmids vom 20. Juni 1941 ist nicht erhalten.
13 Karte vom 28. Dezember 1939, Erich Schmid-Nachlass ZB
14 Brief vom 29. Dezember 1940, Erich Schmid-Nachlass ZB
15 s. Anm. 14
16 Brief vom 6. September 1938, Erich Schmid-Nachlass ZB
17 Leibowitz berichtet im zitierten Brief von Studien bei Webern; es gibt aber keine Dokumente, die dies belegen (in Weberns minuziös geführten Schülerlisten erscheint sein Name nicht). Schmid machte für seinen Entscheid, bei Schönberg und nicht bei Webern zu studieren, im Radiovortrag von 1983 (s. Anm. 9) ausschliesslich (kultur-)
geographische Gründe geltend: "Berlin siegte über Wien."
18 Zu einer persönlichen Begegnung sollte es erst im Jahre 1949 kommen, im Zusammenhang einer Schönberg-Matinée der "Pro Musica" (Zürcher Sektion der IGNM), bei welcher Leibowitz einen einführenden Vortrag hielt und die "Ode an Napoleon" dirigierte.
19 s. Anm. 14
20 zit. nach Hans und Rosaleen Moldenhauer, "Anton von Webern. Chronik seines Lebens und Werks", Zürich 1980,
S. 485
21 s. den Brief Weberns an Willi Reich vom 31. Juli 1942: "Ich danke Ihnen noch sehr dafür, dass es Ihnen gelungen ist, die Partitur meiner "Variationen" von Ansermet zu Reinhart bzhw. Scherchen zu überstellen."
22 Moldenhauer, a.a.O., S. 486
23 zit. nach Moldenhauer, a.a.O., S. 493
24 Unter der – wohl nur in Winterthur für Orchesterkonzerte benutzten – Bezeichnung "Hausabend" werden auch heute noch die unkonventionelleren Programme des Musikkollegiums durchgeführt.
25 Die vom Musikkollegium Winterthur 1947 herausgegebene Broschüre "Die Programme der Konzerte von Hermann Scherchen, 1922–1947" gibt darüber Aufschluss.
26 So Schmid in seinem Radiovortrag 1983, s. Anm. 9
27 Musikkollegium Winterthur, "Festschrift zur Feier des dreihundertjährigen Bestehens, 1629–1929", Zweiter Band "Das Musikkollegium Winterthur 1837–1953", redigiert von Lothar Kempter, Winterthur 1959, S. 290
28 s. Hansjörg Pauli, "Dossier 769033 – Bundesfeierliche Marginalien zum 100. Geburtstag von Hermann Scherchen" in "Dissonanz" Nr. 29 (August 1991), S. 8–13
29 So Webern im Brief an Josef Hueber vom 29. März 1943, zit. nach Moldenhauer, a.a.O., S. 500
30 s. Anm. 9
31 s. Anm. 28
32 Brief vom 4. September 1931, Hermann Scherchen-Archiv der AdK. Weder der vorangegangene Brief Scherchens noch seine Antwort sind vorhanden.
33 s. den Brief Weberns an Erich Schmid vom 13. September 1941
34 zit. nach Moldenhauer, a.a.O., S. 518
35 ebenda
36 Die Metronomzahl 116 bei T. 96 in der Druckausgabe der Universal Edition geht auf einen Irrtum Weberns zurück, der diese Zahl über dem obersten System notierte, über Violine I jedoch korrekt 112.
37 Es war ja Scherchen, der anlässlich des IGNM-Fests 1936 in Barcelona die Uraufführung des Bergschen Violinkonzerts übernahm, nachdem Webern in den Proben aufgrund einer sich ins Detail versenkenden Arbeitsweise zu keinen konzertfähigen Resultaten gelangt war.
38 In einem der beiden Exemplare ist vorne das Original und die Umkehrung der Reihe mit den jeweils drei Viertongruppen notiert, wahrscheinlich von Scherchens Schüler Gianpiero Taverna, dem die Partitur ursprünglich gehörte (die Metronomzahlen stammen aber auch hier von Scherchens Hand). Das zweite Exemplar trägt den Stempel des Kranichsteiner Musikinstituts.
39 Es handelt sich um ein Tonband mit der Nordwestdeutschen Philharmonie in Herford, die Scherchen in den Jahren 1959/60 leitete. Die Ungenauigkeiten lassen auf eine Konzertaufnahme schliessen, andererseits sind deutlich Schnitte hörbar; es könnte sich also um einen unprofessionellen Zusammenschnitt von Probe und Konzert bzw. von mehreren Aufführungen handeln. Die Winterthurer Uraufführung ist leider durch keine Aufnahme dokumentiert worden. Es existieren aber weitere Aufnahmen dieses Werks unter Scherchens Leitung, so mit dem Symphonieorchester des Bayrischen Rundfunks und jenem des Hessischen Rundfunks; es handelt sich dabei um Konzertmitschnitte aus München (20. Februar 1953) bzw. Darmstadt (25. August 1954).
40 Die Aufnahme befindet sich in den Archiven von Schweizer Radio DRS; sie wurde in die in Anm. 9 erwähnte Sendung integriert.
41 In diesem Sinne äusserte sich Schmid gegenüber dem Autor in den frühen 70er Jahren anlässlich der Einstudierung von Werken Schönbergs.
42 s. Hansjörg Pauli: "Hermann Scherchen", 179. Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich, Zürich 1993, S. 44f.
43 Hanns Eisler, "Musik und Politik. Schriften 1948–1962", Leipzig 1982, S. 26–30
44 "Die gegenwärtige Situation der modernen Musik", in "Melos" Jg. 16 Nr. 10, Mainz 1949, S. 257–59, zit. nach Joachim Lucchesi (Hg.): "Hermann Scherchen, Werke und Briefe" Bd. I, Berlin 1991, S. 142–44
45 dokumentiert auf Compact Discs der Label Accord und VM-VAM-VMCC
46 Vortrag am 16. März 1962 in Zürich innerhalb eines Zyklus über "Die Wiener Schule und ihre Auswirkungen auf die heutige Musik", Ms. im Erich Schmid-Nachlass der ZB
47 s. die diesbezüglichen Listen im Booklet der vom Hermann-Scherchen-Verein in Dornach herausgegebenen CD "Hermann Scherchen in der Schweiz. Stationen eines Dirigenten. II. Zürich" (Gravesano 1891–3)
48 s. Anm. 5
49 Ein während der Zivilgefangenschaft in Russland 1914–1918 komponiertes grossangelegtes Streichquartett beweist sein Talent auch in diesem Bereich.
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.