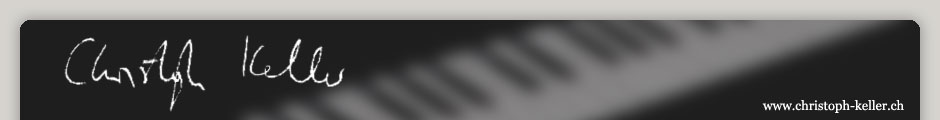Die verhinderte Festschrift: Paul Sacher zum 80. Geburtstag
Niemand wird wollen, dass Paul Sacher die Pülverchen der Hoffmann-LaRoche eigenhändig mischt. Aber wer will eigentlich, dass der Mehrwert, den die Belegschaft besagter Firma jahraus jahrein erarbeitet, mehrheitlich von Paul Sacher angeeignet wird? Ach ja, natürlich, die Komponisten, die von ihm Aufträge erhalten und deren Werke er mit seinen zwei Orchestern, dem Basler Kammerorchester und dem Collegium Musicum Zürich, zur Aufführung bringt. Unsere Tonkünstler sind froh, dass Paul Sacher auf Musik steht und nicht auf alte Automobile, goldene Badewannen oder diamantene Nachttöpfe. Freilich: Den Diener mit den weissen Handschuhen hält auch er sich, seit etlichen Jahren auch einen pistolenbewehrten Bodyguard, und dem Gewicht seiner Persönlichkeit entsprechend bewohnt er eine Festung auf dem Schönenberg bei Pratteln, zusammen mit Maja Sacher-Stehlin, vormals Hoffmann-Stehlin. Seit der violinspielende Gärtnerssohn Paul Sacher 1934 die Witwe des frühverstorbenen Firmengründersohnes Emanuel Hoffmann ehelichte, gehört er zu den reichsten Leuten der Schweiz. In seinem 1974 erschienenen Buch "Die Reichen und die Superreichen in der Schweiz" schätzt Carl M. Holliger das Sachersche Vermögen auf runde drei Milliarden Franken und fügt hinzu: "Müsste Sacher Steuern bezahlen wie jeder andere Bürger, würde er angesichts des riesigen vorhandenen Vermögens gezwungen, Jahr für Jahr von seinen Roche-Aktien zu verkaufen, nur um seine Steuerschulden tilgen zu können." Deshalb – so Holliger – "kommt Sacher in den Genuss des basellandschaftlichen Steuergesetzes, das es dem Regierungsrat ermöglicht, <in Ausnahmefällen> eine von der Norm abweichende Steuererklärung zu akzeptieren."
Ich zitiere jetzt einen andern Autoren, den berühmten Cellisten Mstislav Rostropovich, der unter dem Titel "Dank an Paul Sacher" ein Buch zu dessen 70. Geburtstag herausgegeben hat. Darin schreibt Rostropovich: "Die Mu-sikwelt hat von Paul Sacher eine Menge Kostbarkeiten geschenkt bekommen, und unter diesen Kostbarkeiten auch das Divertimento von Bartók." Sacher soll für dieses "Geschenk" ein paar hundert Franken ausgegeben haben. Fürwahr eine gute Investition: mit den Bartók-Aufträgen hat sich Sacher viel Ruhm für wenig Geld eingehandelt. Bartók starb übrigens wenige Jahre später verarmt in den USA.
So günstige Geschäfte wird er mit einem anderen Grossen dieses Jahrhunderts, mit Strawinsky, kaum haben tätigen können. Denn während Bartók der Musikwelt eine Menge Kostbarkeiten wahrhaftig geschenkt hat, war für Strawinsky die Aussicht auf einen Haufen Geld ein Stimulans des Komponierens. "I like money", antwortete er einmal auf die Frage, warum er komponiere. Der Zürcher Pianistin Margrit Weber, Gattin von EPA-Grossaktionär Karl Weber, knöpfte er für die "Movements" für Klavier und Orchester Ende der 50er Jahre eine sechsstellige Summe ab und musste erst noch angemahnt werden, wenigstens fünf und nicht nur drei magere Sätzlein abzuliefern. Die "Movements" sind im Webernschen Idiom gehalten; dieser äusserst knappe, reduzierte Stil, den Strawinsky in seiner Spätzeit öfters anwandte, ist auch unter pekuniärem Aspekt äusserst ökonomisch: er garantiert einen hohen Stückpreis pro Note. Für Sacher hat Strawinsky ausser dem ebenfalls späten "A Sermon, a Narrative and a Prayer" eines seiner einfallslosesten Werke, ein Streicherconcerto in D geschrieben – Dutzendware in neoklassizistischer Machart. Wieviel Sacher dafür gezahlt hat, wird man von ihm nicht erfahren, denn – so erklärte er einmal in einem öffentlichen Gespräch mit Gerd Albrecht, der es gewagt hatte, diesen Themenbereich anzupeilen – "es gibt zwei Sachen, über die der Schweizer nicht gern redet: über seine Liebschaften und über seinen Steuerzettel". Der Schweizer, bzw. der Sacher, betrachtet Geld als zur Intimsphäre gehörend; dort scheint es ihm am besten vor neugierigen Blicken geschützt, und gewisse Gedanken sind dann einfach unanständig, obszön.
Verlassen wir also diese geschützte Zone und begeben uns auf ein allgemeineres Gelände. Kommen wir nochmals zurück auf die private Aneignung gesellschaftlich produzierten Mehrwerts. Nun denn: Als Mehrwert bezeichnet man jene Summe, um die der Wert eines gegebenen Produkts grösser ist als der Wert der in ihm vergegenständlichten Arbeit (inklusive Rohstoffe, Amortisation der Maschinen usw.). Dieser Mehrwert wird – wie man weiss – in unserem Wirtschaftssystem privat angeeignet und fliesst zu einem schönen Teil als Dividende in die Taschen jener, welche Eigentumstitel auf die betreffenden Kapitalien horten. Ein Teil des Mehrwerts geht zwar in Form von Steuern an die Gesellschaft oder vielmehr den Staat, der setzt es aber – oh munterer Kreislauf! – gerne zur Äufnung neuen Mehrwerts ein, zum Beispiel in Form von Aufträgen an die Rüstungsindustrie. Ausgaben, die allen oder wenigstens vielen zugute kommen, sind bei der bürgerlichen Mehrheit, die den Staat im Griff hat, weniger beliebt; "Giesskannenprinzip" heisst der verächtliche Terminus jener, welche dicke Schläuche in die eigenen Taschen bevorzugen. Noch weniger geschätzt als Sozialausgaben sind Kulturausgaben; da erscheint schon die Forderung nach einem einzigen Prozent des Budgets als unakzeptable Anmassung. Steigen wir noch einmal ein paar Stufen hinunter in der Beliebtheitsskala, so treffen wir auf die Tonkünstler genannten Neutöner: Kaum einer von ihnen kann von seiner kompositorischen Arbeit leben, denn für ihre Werke hat der Staat so gut wie nichts übrig und auch seine Radioanstalt hat sich von Kompositionsaufträgen inzwischen dispensiert. Da nun tritt unser Jubilar auf den Plan – und die Komponisten danken's ihm, zum Beispiel mit Variationen über Es - A - C - H - E -Re zu seinem Siebzigsten, oder mit 8x80 Sekunden zu seinem Achtzigsten. Letztere Hul-digung brachte der Tonkünstlerverein seinem ehemaligen Präsidenten und heutigen Ehrenpräsidenten Paul Sacher an seinem Fest in Fribourg dar. Auch Jacques Wildberger hat sich daran beteiligt, obwohl er, der seit Jahrzehnten in der Sacher-Hochburg Basel tätig ist und gewiss zu den interessantesten Schweizer Komponisten gehört, von Sacher nie einen Kompositionsauftrag erhalten hat. Ob diesem Wildbergers Nase, seine politische Gesinnung oder seine Musik nicht gefällt, ist nicht auszumachen, und im Grunde ist es auch egal, denn der Privatmäzen Sacher ist niemandem Rechenschaft schuldig. Er hat es nun einmal vorgezogen, seinem Freund Conrad Beck, einem bieder-harmlosen Provinzkomponisten, ein rundes Dutzend Kompositionsaufträge zu erteilen. Aber Wildberger kann sich trösten, er befindet sich in bester Gesellschaft. Auch Berg, Schönberg und Webern haben – im Gegensatz zu Bartók und Strawinsky – von Sacher nie einen Auftrag erhalten. Ich hatte einmal – vor über zehn Jahren – geschrieben über die "Funktion des Neoklassizismus als vornehme leichte Musik für das Bürgertum, das mit seiner Komponisten-Avantgarde, der Neuen Wiener Schule Arnold Schönbergs, weder Schritt halten konnte noch wollte. Weshalb Paul Sacher als Exponent des Grosskapitals intensiv die neoklassizistische Richtung unterstützte, die Neue Wiener Schule aber ignorierte, wird deutlich, wenn wir uns vergegenwärtigen, was Hanns Eisler 1954 über Arnold Schönberg schrieb: <Die gesellschaftliche Ordnung, in die er hineingeboren war, hat er nicht verklärt und nicht beschönigt. Er hat nichts geschminkt. Er hat seiner Zeit, seiner Klasse einen Spiegel vorgehalten. Es war gar nicht schön, was man da sah. Aber es war die Wahrheit.>" Ich schrieb bzw. zitierte dies in der Rezension eines Konzertes des Sacherschen Collegium Musicum Zürich, die von der damaligen Basler "National-Zeitung" in Auftrag gegeben worden war, aber nicht publiziert wurde. Nun gut, meine Interpretation war vielleicht etwas hochgegriffen, vielleicht auch etwas kurzschlüssig, obwohl eine der jüngsten Sacher-Uraufführungen, ein äusserst virtuoses Violinkonzert, das Witold Lutoslawski für Anne-Sophie Mutter schrieb, wieder den Gedanken nahelegte, dass Sachers Engagement nicht zuletzt darauf abzielt, traditionelles Publikum, grosse Namen und neue Musik auf einen Nenner zu bringen, was dann zu ebenso bekömmlichen wie belanglosen Kompositionen führt. Aber Paul Sacher, der sich gerne attestieren lässt, bedeutende Komponisten vor ihrem "Durchbruch" gefördert zu haben, hat sich im Falle der Wiener Schule ganz einfach vertan, und um vor der Geschichte, in die er hauptsächlich mit der nach ihm benannten Stiftung einzugehen gedenkt, doch etwas besser dazustehen, hat er noch schnell, neben dem Strawinskyschen, auch den Webernschen Nachlass eingekauft. An dieser Stelle ist wieder einmal ein Zitat fällig. Es stammt aus Hans Oeschs Aufsatz "Paul Sacher – Versuch einer Würdigung". Da liest man: "Keiner der grossen Namen fehlt in der Liste dieser Auftragswerke. Nur zu Kompositionsaufträgen an Arnold Schönberg, Alban Berg und Anton Webern ist es nie gekommen." Das hat etwa die gleiche Logik, wie wenn man über einen Fürsten des 18. Jahrhunderts sagen würde: "Ausser Haydn, Mozart und Beethoven haben alle grossen Klassiker für ihn komponiert." Nicht weniger erheiternd sind Oeschs Entlastungsargumente: Schönberg sei seit seiner 1934 erfolgten Emigration nach Amerika nur mehr schwer erreichbar gewesen – grad so, als wär er an Columbus' Seite in Amerika gestrandet – und Webern habe die Nachkriegszeit nicht erlebt – was zwar stimmt, nur gilt es auch für Bartók, der ja bekanntlich von Sacher Aufträge erhalten hat. Doch solche Ungereimtheiten fechten den Herrn Ordinarius für Musikwissenschaft an der Universität Basel in seinem Würdigungseifer nicht an.
Oesch empfahl sich für das Professorenamt unter anderem als Verfasser der Festschrift zum hundertjährigen Bestehen der Basler Musikakademie im Jahre 1967. Damaliger Direktor dieses Instituts: Paul Sacher. Derselbe Sacher war Mitglied der Expertenkommission im Berufungsverfahren, das im selben Jahr 1967 zur Wahl von Hans Oesch führte, obwohl mit Ludwig Finscher ein qualifizierterer Musikwissenschaftler zur Verfügung gestanden hatte. Seit 1975 ist Ordinarius Oesch auch Präsident der Basler Orchester-Gesellschaft (BOG), und für Sacher ist es sicher nicht gleichgültig, wer diesen Posten besetzt. Denn das von ihm geleitete Basler Kammerorchester ist de facto weitgehend eine Formation der BOG. Via BOG subventioniert der Staat die Konzertveranstalter, denn diese zahlen nur etwa zehn Prozent der effektiven Orchesterkosten. Sacher nun geniesst gegenüber anderen Konzertveranstaltern eine Reihe von Privilegien im Verhältnis zur BOG: Er hat Priorität bei der Zuteilung der Orchesterdienste und erhält für seine Konzerte die grössten Probenkontingente. Zudem kann er Einfluss auf die personelle Zusammensetzung des Orchesters nehmen: BOG-Musiker, die ihm nicht genehm sind, dürfen in seinen Konzerten nicht spielen. Pikant ist ferner, dass das Sachersche Basler Kammerorchester im Gegensatz zur Allgemeinen Musikgesellschaft, dem grössten Basler Konzertveranstalter, nicht nur über die BOG subventioniert wird, sondern zusätzlich eine direkte Finanzspritze von einer Viertelmillion jährlich erhält, so dass sich die Frage aufdrängt, wer hier eigentlich wessen Mäzen ist.
Wenn Sacher trotzdem am Ende der Saison noch "Generalunkosten" von einer halben Million verbleiben, dann liegt das nicht nur an seinem Engagement für die neue Musik, sondern auch daran, dass er sich die teuerste internationale Solistenprominenz leistet. Cellist Rostropovich zum Beispiel kassiert pro Abend 30'000 Franken, und ist im Gegensatz zur Usance nicht bereit, bei einer Wiederholung des Konzertes am folgenden Tag, sich mit der halben Gage zu bescheiden. Wäre ja auch allzu schäbig, 15'000 Franken für ein ganzes Konzert, nachdem der arme "Slava" so lang in der Sowjetunion darben musste! Zu seinem Eintritt in den goldenen Westen hat ihm Paul Sacher denn auch ein Stradivarius-Cello geschenkt. Dafür spielt Rostropovich in der Schweiz exklusiv unter der Leitung Sachers. Umgekehrt durfte Sacher den berühmten Cellisten auch schon mal mit den Berliner Philharmonikern begleiten. Kommentar eines Philharmonikers: "Da hat uns doch neulich so ein Industrieller aus der Schweiz dirigiert..."
Nichts Wichtiges geschehe in Basel und auch sonstwo im Schweizer Musikleben, wo Sacher nicht seine Hände im Spiel habe oder mindestens seinen Segen dazu gebe. So oft man dies zu hören bekommt, so schwierig sind konkrete Informationen über diesen Filz von Kultur, Industrie und Politik zu erhalten. Sein privates Kapital und die daraus sich ergebenden Verbindungen und Machtpositionen erlauben es jedenfalls Sacher, Einfluss auch auf öffentliche Institutionen zu nehmen. So war er der Universität Basel, deren Ehrendoktor er ist, beim Ausbau ihres musikwissenschaftlichen Instituts behilflich. So brachte er die von ihm aufgebaute Schola Cantorum Basiliensis samt Gebäude in die Basler Musik-Akademie ein und sich selber ans Ruder dieser Institution. Es ist ein offenes Geheimnis, dass Sacher auch noch viele Jahre nach seinem Rücktritt bei der Besetzung dieser Stelle das Sagen hat. Kein Wunder, wo doch Hoffroche-Direktor Graffenried Präsident des Stiftungsrates der Musik-Akademie ist! 1974 wurde dem erstaunten Lehrerkollegium der weithin unbekannte Friedhelm Döhl vor die Nase gesetzt. In der Berufungskommission sass Wolfgang Fortner, der im Auftrage Sachers eine ganze Reihe von Kompositionen geschrieben hatte. Döhl war Schüler Fortners. Rudolf Kelterborn, der damals übergangen wurde, schaffte es erst 1983, Direktor der Musik-Akademie zu werden. Dafür wurde er im folgenden Jahr gleich mit zwei wichtigen Preisen dekoriert: mit dem Kunstpreis der Stadt Basel und mit dem Komponistenpreis des Schweizerischen Tonkünstlervereins. In beiden Jurys sass Paul Sacher, in letzterer gar als Präsident.
Als vor ein paar Jahren die Neubesetzung des Zürcher Lehrstuhls für Musikwissenschaft anstand, liess Sacher, der mit dem Zürcher Erziehungsdirektor Gilgen befreundet ist, den Berliner Musikwissenschaftsprofessor Carl Dahlhaus brieflich wissen, falls er sich für die Professur an der Universität Zürich interessiere, liesse sich etwas machen. Doch Dahlhaus wollte nicht, und als schliesslich der lange am Basler Musikwissenschaftlichen Institut tätige Ernst Lichtenhahn zum Extraordinarius berufen wurde, brüstete sich Sacher, zu Gilgen gesagt zu haben, nun habe er – Gilgen – den ersten richtigen Schritt getan (indem er Lichtenhahn zum Extraordinarius machte), nun müsse er nur noch den zweiten tun (nämlich Lichtenhahn zum Ordinarius befördern). Wundert es noch jemanden, dass die Musikwissenschaft just mit Ernst Lichtenhahn und Hans Oesch im Stiftungsrat der Paul-Sacher-Stiftung vertreten ist?
Doch spüren wir nicht weiter dem Musikpolitiker Sacher auf seinen weitverzweigten Gängen nach – wir bekommen sonst noch Scherereien mit seinem Bodyguard –, sondern fassen wir ihn da ins Auge, wo er sich öffentlich darstellt: als Dirigent. Da fällt zunächst einmal die Gradlinigkeit auf, mit der er den Takt markiert. Keine Spur von Show, aber auch wenig Übereinstimmung mit der erklingenden Musik. Ob piano oder forte, espressivo oder marcato, es geht immer eisern auf- und abwärts. Musik des 20. Jahrhunderts ist oft schwer zu dirigieren, etwa die zusammengesetzten und häufig wechselnden Taktarten bei Strawinsky; man hat da gewiss mehr Gelegenheiten, sich zu vertun, als in älterer Musik. Bei neuer Musik verwandelt sich der Orchesterproberaum schon mal in einen Kindergarten. Nicht so bei Sacher. Niemand traut sich, seine Anweisungen zu kommentieren, etwa gar seine Kompetenz in Frage zu stellen. Im Gegenteil: Die Musiker geben sich alle Mühe, trotz Sachers mässigen Dirigaten einigermassen gute Aufführungen hinzukriegen. Es zeigt sich hier ein Phänomen, das etwa auch beim greisen Karl Böhm zu beobachten war, dessen Gesten in seinen letzten Jahren kaum mehr in einen sinnvollen Zusammenhang mit der Musik zu bringen waren, was aber keineswegs zu schlechteren Resultaten als den üblichen führte. Man kann daraus schliessen, dass die Autorität eines Dirigenten weniger von seiner Sachkompetenz als von seiner Stellung in der gesellschaftlichen Hierarchie abhängt. Paul Sacher kann es sich als einziger Dirigent weit und breit auch leisten, die Dreistunden-Grenze für Orchesterproben zu überschreiten – ein Sakrileg, das sonst von Orchestermusikern schlicht mit Verweigerung quittiert wird. Bei Sacher riskieren sie nicht einmal einen Hinweis. Solche Grosszügigkeit – oder ist es Duckmäusertum? – wird ihnen allerdings schlecht vergolten: Mit seinem Orchester auf Kreuzfahrt im Mittelmeer lässt sich der Boss nicht erweichen, eine Probe zu unterbrechen, um den Musikern einen Blick auf die Strasse von Messina zu gewähren; autoritär besteht er darauf, dies sei eine Arbeitsprobe und keine Sight-Seeing-Tour.
Er betrachte seine Musiker nicht als Partner, sondern kompensiere Unsicherheit mit autoritärem Gehabe, sagt Karl Scheuber, der eine zeitlang für Sacher den Basler Kammerchor präparierte und fristlos entlassen wurde, als er es wagte, für den Fall der Nichterfüllung einer Reihe von künstlerischen Forderungen eine vorsorgliche Kündigung einzureichen. Erst die Drohung mit Arbeitsgericht bewog Sacher, wenigstens das fällige Honorar auszuzahlen.
Dass Sacher kein begnadeter Dirigent ist, ist ziemlich bekannt, und doch sind Besprechungen seiner Konzerte meist sehr wohlwollend. Denn Kritik kann dieser mächtige Mann nicht gut ertragen. Als Daniel Fueter einmal Kritisches in der Basler "National-Zeitung" zu äussern wagte, setzte Sacher alle Hebel in Bewegung, um den unbotmässigen Schreiber zu identifizieren, und als sich dieser als Sohn des Condor-Film-Inhabers Heinrich Fueter entpuppte, konnte der aufgebrachte Dirigent und Kapitalbesitzer nur noch von vernünftigeren Managern davon abgehalten werden, einen Werbefilm-Auftrag der Hoffroche bei Condor rückgängig zu machen. Zeigt sich in solch wenig souveräner Handlungsweise der aufgestiegene Kleinbürger, der stets noch seine Macht bedroht sieht? Von Musik, die Herrschaft in Frage stellt, hat Paul Sacher jedenfalls nie etwas gehalten. John Cage oder Hanns Eisler, diese beiden Grossen, die paradigmatisch für zwei verschiedene Richtungen antibürgerlicher Musik unseres Jahrhunderts stehen, wird man in seinen Programmen vergebens suchen. Cages ästhetische Modelle einer herrschaftsfreien Gesellschaft sind sicher nicht nach dem Geschmack dieses Dirigenten. Und wer will es dem Chemiemagnaten verübeln, dass er nichts für Hanns Eisler übrig hat, der mit seiner Musik dem Sozialismus nützen wollte, jenem System also, in dem der gesellschaftlich produzierte Mehrwert gesellschaftlich angeeignet wird, wo doch Paul Sacher gerade dank seiner privaten Aneignung von Mehrwert in die Lage versetzt wird, das Gute und Grosse in der Kunst zu fördern? Widmen wir also ihm und all seinen Freunden zum Abschluss ein Lied von Hanns Eisler auf einen Text von Bertolt Brecht; es heisst: "Lied von der belebenden Wirkung des Geldes".
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.