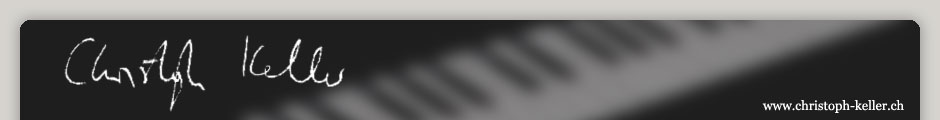Das Neue als das Bessere. Zu Hermann Scherchens Beethoven-Verständnis
Laut Riemann Musiklexikon war Harry Goldschmidt Schüler von Hermann Scherchen in Königsberg,1 wo dieser von 1928–31 die städtischen Sinfoniekonzerte leitete und musikalischer Oberleiter am Ostmarken-Rundfunk war. Da diese Jahre in die lange Zeitspanne (1923–50) fallen, während der Scherchen beim Winterthurer Stadtorchester als ständiger Gastdirigent (de facto als Chefdirigent) tätig war, mutet es etwas seltsam an, dass Goldschmidt, der im Prinzip bis 1948 in Basel lebte, nicht zu den Schweizer Schülern Scherchens gehört zu haben scheint. Immerhin erwähnt Goldschmidt im Nachruf auf Scherchen dessen Sommerkursus 1942 in Gstaad im Berner Oberland, wobei offen bleibt, ob er dort als Mitwirkender oder Zuhörer teilnahm (Goldschmidt 1966, 223). In der selben, ausführlichen Würdigung berichtet er von "'Nachtgesprächen' mit seinem einstigen Lehrer" und von einem Briefwechsel Mitte der fünfziger Jahre (Goldschmidt 1966, 209 bzw. 201f.). Dabei scheint es vor allem um die Frage gegangen zu sein, ob zwischen sozialistischer politischer Haltung und avantgardistischer künstlerischer Praxis ein Widerspruch bestehe, was Scherchen vehement verneinte. Goldschmidt, der damals in der DDR lebte, bemüht sich im Nachruf, die "grade Linie" (Goldschmidt 1966, 201, 212) des Lehrers den in ästhetischer Hinsicht eher renitenten Genossen nahe zu bringen, wobei er es an Seitenhieben auf die westliche Avantgarde allerdings nicht fehlen lässt.2 Einiger als in der Beurteilung zeitgenössischer Musik war Goldschmidt mit Scherchen in der Wertschätzung Beethovens, und zwar auch solcher Nebenwerke wie des berüchtigten Tongemäldes "Wellingtons Sieg oder die Schlacht bei Vittoria". Die Popularität bei den Zeitgenossen rechnete Goldschmidt dem "ominösen Opus 91" zum Vorteil an und würdigte das Werk als "politischen Beitrag des Künstlers Ludwig van Beethoven an die Nation, den das Volk ihm nicht vergass" (Goldschmidt 1976, 27). Während für Goldschmidt das Opus 91 den "absoluten Höhepunkt" der Gattung Schlacht-Sinfonie markierte (Goldschmidt 1976, 25), hielt Scherchen es gar für "eines der schönsten und ungezwungensten Werke der Musik" überhaupt (Lucchesi 1991, 214). Seine mit vielen Erläuterungen gespickte Probenarbeit an diesem Werk ist in einer filmischen Aufzeichnung festgehalten worden.
Scherchen war fortschrittlich aus Prinzip, sozusagen ein fundamentalistischer Progressiver. Seine Sympathie für die im Entstehen begriffenen sozialistischen Staaten der Nachkriegszeit, welche notabene zu seinem Rauswurf aus allen Schweizer Positionen3 führte (Pauli 1993, 44f.), dürfte eher aus dieser teleologischen Weltsicht zu erklären sein als aus einer Übereinstimmung mit den Positionen der kommunistischen Parteien im einzelnen. Anders als etwa der ebenfalls dem Schönberg-Kreis entstammende Hanns Eisler teilte er nicht die ästhetischen Positionen, die im Prager Manifest von 1948 formuliert waren.4 Dem Postulat einer Kunst für das Volk hielt er entgegen, dass kein erstrangiger Komponist je zu einer "natürlicheren", bequemer verständlichen Ausdrucksweise zurückgekehrt sei. Die marxistische Konzeption von Kunst als "Überbau", der die Gesellschaft widerspiegelt, reinterpretierte er im Sinne der künstlerischen Avantgarde: Die Gesellschaft sei ein Werdendes, das über gewissen Grundlagen immer feinere, neue Organe entwickle, deren Vorkämpfer eben die "wahrhaften Künstler" seien – paradigmatisch standen ihm dafür der Bach der "Kunst der Fuge", der Beethoven der "Grossen Fuge" und der Verdi der "Pezzi sacri". Diese Gedanken stehen in Scherchens Bericht vom Mailänder Zwölftonkongress vom 5. Mai 1949 (Lucchesi 1991, 142–144), dem er vorwirft, sich mit seiner "Kompromiss-Tüchtigkeit" selbst überflüssig gemacht zu haben. Der unter dem Titel "Die gegenwärtige Situation der modernen Musik" erschienene Bericht endet mit dem Satz: "Die Welt geht vorwärts und der Geist triumphiert" – eine Devise, die Scherchens Wirken bis hinein in seine Dirigierweise mit ihrem vorwärts treibenden Impetus geprägt hat. Dass das "später Kommende das Sinnvollere, das Neue das Bessere, das Abschliessende auch das Vollendete" sei, war eine Überzeugung, die er im Beethovenschen Finale realisiert fand, das sich eben dadurch vom Mozartschen abhebe (Lucchesi 1991, 105).5 Er fand Beethoven, den politisch "engagierten" Musiker, von der deutschen romantischen Schule und deren Verlangen nach pathetischem Ausdruck entstellt (Lucchesi 1991, 212); die Geringschätzung für "Wellingtons Sieg oder Die Schlacht bei Vittoria" führte er darauf zurück, dass Beethoven seit mehr als hundert Jahren wegen seiner Feierlichkeit verehrt werde (Lucchesi 1991, 214). Diesem Feierlichkeitskult wollte er mit der Restitution der originalen Texte und insbesondere mit den authentischen Tempi zu Leibe rücken.
Er hatte offenbar sogar die Absicht, ein Buch zu schreiben, dem "das Bestreben zu Grunde liegt, die interpretativen Probleme, die die ästhetisch-künstlerischen der Beethovenschen Sinfonik begleiten, in den Hintergrund drängen und oft verschleiern, so darzustellen, dass sie als Gefahrenquelle erkannt und von jedem ernsthaften Orchestermusiker und Dirigenten in günstiger Weise bewältigt werden können". Das Projekt gedieh allerdings nicht über das einleitende Kapitel hinaus, und zu einer Publikation ist es nicht gekommen. Deshalb sei hier ein Einblick in dieses hochinteressante Dokument einer auf die Quellen rekurrierenden Neuinterpretation Beethovens gegeben.6
Scherchen weist zunächst auf die Bedeutung der Beethovenschen Bezeichnungen hin und stellt fest: "Leider weisen selbst die guten Partiturausgaben der Sinfonien, wie die Breitkopfs oder die Peters (ebenso aber auch die Studien-Partiturausgaben des Eulenburg- und Philharmonia-Verlages) eine Menge willkürlicher Änderungen auf, die in einzelnen Fällen bis zu völlig Sinn umändernden Korrekturen des Textes der noch von Beethoven selbst gebilligten und gesehenen Erstdrucke seiner Sinfonien gehen. Diese Tatsache hat es nötig gemacht, den Text der Manuskripte (soweit sie vorhanden sind) und der noch viel wichtigeren Erstdrucke noch einmal einer Untersuchung und einem Vergleich mit dem der in Gebrauch befindlichen Partituren zu unterziehen, um einer künftigen Beethoveninterpretation das Originalwerks des Meisters – und dieses allein – zu Grunde zu legen." Der Rekurs auf die Originale widersprach auch der damals (und auch heute z.T. noch) gängigen Praxis der Instrumentationsretuschen, wobei Scherchen gerade in dieser Hinsicht einen interessanten, nicht bloss auf den Urtext fixierten Standpunkt vertrat. Wenn schon, nämlich wenn damit eine Uminterpretation beabsichtigt sei, müssten die Retuschen seiner Meinung nach weit radikaler vorgenommen werden, als es meist der Fall ist. "Will man jedoch nur Stellen 'verbessern', die (sicherlich) nur aus den begrenzten Gebrauchsmöglichkeiten der Naturhörner und -trompeten seiner Zeit Beethoven gerade so konzipiert hat, so genügt eine 'Verbesserung' wieder nicht, weil Beethovens ganze Instrumentation in allen solchen Fällen genau in Hinsicht auf jene Beschränkungen angelegt ist, also viel weiter gehende Änderungen auch hier wieder nötig würden. So bleibt nur eins übrig: aus der Klangvorstellung des ganzen Werkes solche vereinzelten Stellen so sorgfältig einzuordnen und abzuwägen in ihren klanglichen Energien, dass Beethovens Klangidee realisiert wird, so wie er selbst verstanden hat, der naturgegebenen Begrenzungen durch die noch nicht gleichmässig entwickelten Instrumente Herr zu werden." Die dafür nötigen "technischen Massnahmen" verspricht Scherchen später darzustellen, wozu es ebensowenig kam wie zu den "speziellen Untersuchungen", in die er nach einer Übersicht über Beethovens Metronomisierungen eintreten wollte.
Die Metronomisierungen ordnete Scherchen "nach ihrer Beschleunigung von der ruhigsten Bewegung an", beginnend mit 8tel=63 für das Adagio (Einleitung) des letzten Satzes der I. Sinfonie bis 8tel=120 für Andante cantabile con moto (2. Satz der I. Sinfonie), gefolgt von entsprechenden Tabellen für 4tel, 4tel mit Punkt, Halbe, punktierte Halbe und Ganze, wobei neben der verbalen Tempobezeichnung stets das Metrum des betreffenden Satzes mitvermerkt ist. In jedem Abschnitt gibt es Anmerkungen zu strittigen Fälle bzw. üblichen Entstellungen oder zum Verhältnis von Satztypus, Metrum, verbaler Bezeichung und Metronomisierung. (Scherchen weist darauf hin, dass die Bezeichnungen des Metrums weit mehr den metrischen Charakter als die praktisch benötigten Zähleinheiten festlegen und ebensowenig wie die Metronomangaben als dirigierpraktische Ausführungsangaben zu verstehen sind). Im Falle der Ganzen=116 für das Presto (im Trio des Scherzos der IX. Sinfonie) plädiert Scherchen energisch für die Richtigkeit der Angabe, meint gar, "dass es sich hier nicht um einen wirklichen, sondern nur um einen von Querulanten angenommenen Schreib- resp. Druckfehler handelt", da "die Beschleunigung der kleinsten Takteinheiten, der Viertel, eine ganz normale bei der Steigerung: drei Viertel=116 in Ganze=116, ist; die Viertel selbst gewinnen so aus der Schnelligkeit Viertel=348 im Anfang den Wert Viertel=464 im Trio". Angesichts dieser klaren Sachlage erübrige es sich, "gegen solche Auffassungstendenzen zu polemisieren, die Beethoven verändern wollen, weil ihnen seine Absicht einer in die doppelte Einheitsgeschwindigkeit mündenden Beschleunigung aus 'Ausdrucksgründen' nicht behagt".
Generell kritisiert Scherchen die üblicherweise zu langsam genommenen Tempi, weist darauf hin, dass "Beethoven die Tempobezeichnungen durchaus noch im italienischen Wortsinne versteht; z.B. ist 'Andante' ein leicht bewegtes ('gehendes') Tempo, und nicht die Angabe für einen breit ausgesponnen, sentimental gedehnten Gesang". Aber als Dialektiker sieht Scherchen auch, "wie sich gleichzeitig mit dem Festhalten des ursprünglichen Wortsinnes in den Bezeichnungen dennoch bei Beethoven schon jene Weitung (oder besser Differenzierung) in der Verständnismöglichkeit der traditionellen Worte und Werte anbahnt, die auch sonst überall mit ihm beginnt. Alle traditionellen Werte erhalten Hintersinn, enthüllen ihre Mehrdeutigkeit, mit einem Worte: unterliegen lebendiger Verwandlung – ohne deshalb aufgegeben zu werden."
Die Feststellung, es schöben sich immer mehr Tempocharaktere an Stelle der Temposchemata, deckt sich mit den Prämissen von Rudolf Kolischs 1943 in den USA erschienener Untersuchung zu Tempo und Charakter bei Beethoven. Scherchen dürfte diese im Ansatz vergleichbare, obzwar – da auch die nicht metronomisierten Sätze einbeziehende – viel umfassendere Abhandlung kaum gekannt haben, wenn nicht gar sein Text vor jenem Kolischs entstanden ist; aber über die Zugehörigkeit zum Schönberg-Kreis haben beide Musiker/Autoren eine gemeinsame Wurzel. Gemeinsam ist ihnen auch die Überzeugung, dass es nicht angeht, aus Gründen der instrumentaltechnischen Bequemlichkeit oder Beschränktheit die Beethovenschen Tempovorschriften zu ignorieren. So schreibt Scherchen a propos der mit Ganze bzw. Halbe=80 metronomisierten Ecksätze der IV. Sinfonie: "Einmal wird aus der Metronomvorzeichnung 'Ganze' für den 1. Satz 'Halbe' gemacht, ein plumpes, schwerfälliges Pathos aus beschwingter, erlöster Heiterkeit; ein ander Mal wieder muss der letzte Satz 4tel=126 etwa genommen werden – angeblich weil sonst die konzertierenden Solisten des letzten Satzes: Solo-Fagott, Solo-Clarinette, und dann alle Contrabässe und Violoncelli, ihre Stimme nicht ausführen können. Nun ist aber der ganze letzte Satz das übermütigste Spiel mit dem Orchester, wobei die exponiertesten Instrumente eines nach dem andern gerade als Solisten hervortreten sollen. Der Witz des Satzes ist weg, wenn das Tempo für diese Solisten nicht fast 'lebensgefährlich' wird."
Nun, ein zumindest für den Solofagottisten beinahe lebensgefährliches Tempo, eben exakt das von Beethoven geforderte, hat Scherchen in der Tat angeschlagen, als er dieses Werk 1965 im Rahmen einer Gesamtaufführung der Beethovenschen Sinfonien mit dem Orchestra della Radio Svizzera Italiana in Lugano spielte. Es war dies übrigens sein erster Auftritt in der Schweiz nach dem Rauswurf von 1950 (in der deutschen Schweiz, dem Schauplatz der gegen ihn geführten antikommunistischen Kampagne, hat er notabene nie wieder dirigiert). Und Scherchen ist sich ganz treu geblieben, indem er in diesem Konzertzyklus den Beethoven-Sinfonien jeweils die Uraufführung eines neuen Werks voranstellte. Noch mit 74 Jahren hiess seine Devise "vorwärts" und trieb er das Orchester mit ungeheurer Energie und Kraft an – gelegentlich auch mit Rufen im Konzert! Wer wollte – oder das Glück hatte –, konnte schon damals (und kann dank der Reeditionen auf CD heute noch) einen Beethoven in raschen Tempi und ungeschönter Klanglichkeit erleben und brauchte nicht auf die selbsternannten Entdecker einer "authentischen Aufführungspraxis" zu warten, um eine Alternative zum Wirtschaftswunder-Beethoven eines Karajan zu haben.
Dass Scherchen für sein Beethoven-Vermächtnis kein besseres Orchester zur Verfügung hatte, war künstlerisch keineswegs ein Nachteil – im Gegenteil: die Tessiner Radiomusiker waren unbelastet von der pathetischen Beethoven-Tradition germanischer Provenienz und deshalb offen für Scherchens Konzeption,7 zu der ein an den Limiten agierendes Orchester ohnehin besser passt als der wohlgenährte, abgerundete Klang eines philharmonischen Spitzenensembles. Der einzige Nachteil war, dass die Wirkung dieser Aufführungen in der Provinz beschränkt blieb, zumal sie erst ab den späten 80er Jahren auf Tonträgern veröffentlicht wurden.8
Literaturverzeichnis
- Goldschmidt 1966
Harry Goldschmidt: "Hermann Scherchen – Gedanken und Aufzeichnungen", in: Musik und Gesellschaft 16 (1966), H. 8/9, zit. nach: Harry Goldschmidt: "Um die Sache der Musik. Reden und Aufsätze", Leipzig 1976, S. 200-225 - Goldschmidt 1976
Harry Goldschmidt: "Das ominöse Opus 91", in: "Um die Sache der Musik. Reden und Aufsätze", Leipzig 1976, S. 20–27 - Goldschmidt 1987
Harry Goldschmidt: "Scherchen in Vichy?", in: Beiträge zur Musikwissenschaft 29 (1987), H. 1, S. 75–77 - Klemm 1986
Eberhardt Klemm: "Eisler und Scherchen – Prag oder Vichy", in: Beiträge zur Musikwissenschaft 28 (1986), H. 2, S. 117–121 - Kolisch 1943
Rudolf Kolisch: "Tempo and character in Beethoven's music", in: Musical Quarterly 29 (1943), S. 169–187 und 291–312; dt. in: Musik-Konzepte 76/77, München 1992 - Lucchesi 1991
Joachim Lucchesi (Hg.): "Hermann Scherchen. Werke und Briefe", Band I, Schriften I, Berlin 1991 - Niemann 1987
Konrad Niemann: "Harry Goldschmidt zum Gedenken", in: Beiträge zur Musikwissenschaft 29 (1987), H. 3, S. 195–197 - Pauli 1993
Hansjörg Pauli: "Hermann Scherchen 1891–1966", 177. Neujahrsblatt der Allgemeinen Musikgesellschaft Zürich, Zürich 1993
1 Auch der Nachruf in den vom Verband der Komponisten und Musikwissenschaftler der DDR herausgegebenen "Beiträgen zur Musikwissenschaft" macht diese Angabe (Niemann 1987, 195).
2 So spricht er von der "undialektischen Konzeption der 'stochastischen Musik'" Xenakis' und von der "Scharlatanerie" Stockhausens, wobei er für diese – durchaus SED-linientreue – Abqualifizierung sogar Scherchen als Kronzeugen anführt (Goldschmidt 1966, 215f.).
3 Ausser beim Musikkollegium Winterthur, dem Träger des Winterthurer Stadtorchesters, war Scherchen als Leiter des Studio-Orchesters Beromünster bei der SRG (Schweizerische Rundspruchgesellschaft) angestellt.
4 Zum Verhältnis der Positionen Eislers und Scherchens notierte Harry Goldschmidt einigermassen pointiert und im Falle Eislers nur bedingt zutreffend: "Anders als für Eisler, der an der Priorität der Politik über die Kunst keinen Abstrich duldete, war Scherchen nicht dafür zu haben, die Kunst der Politik (in welcher Richtung auch immer) zu opfern, weil sie ihm selbst eine unantastbare zukunftsweisende Wesensäusserung menschlicher Produktivkraft war." (Goldschmidt 1987, 77) Goldschmidt replizierte mit diesem Beitrag auf Eberhardt Klemm, der in Bezug auf die Internationalen Musikfeste in Prag und Vichy 1935 die im Vergleich zu Scherchen parteilichere und konsequentere Haltung Eislers hervorgehoben hatte (Klemm 1986, 117).
5 Ausgehend von der motivischen Verwandtschaft des 3. Satzes von Beethovens V. mit dem 4. Satz von Mozarts g-Moll-Sinfonie KV 550 legt Scherchen den Unterschied zwischen den beiden dar: "Für Beethoven konnte Mozarts Tonfolge nicht mehr der thematische Träger eines Finales sein! Er hatte gesehen, wie die Welt umgeändert worden war, wie neue Kräfte die Stelle vieler für unverrückbar gehaltener Ordnungen eingenommen hatten. Der Abschluss (das 'Finale') war für ihn so mehr als nur ein letzter Satz: das später Kommende sollte das Sinnvollere, das Neue das Bessere, das Abschliessende auch das Vollendete sein!" (Lucchesi 1991, 105)
6 Das sechs Seiten umfassende Typoskript befindet sich im Hermann Scherchen-Archiv der Akademie der Künste Berlin. Es ist undatiert; dass Scherchen dafür Papier des Hotels Krone, Winterthur, benutzte, lässt vermuten, dass es vor 1950 entstanden ist. Das vorige und alle folgenden Zitate stammen aus diesem Text.
7 In den Beethoven-Aufnahmen Scherchens mit dem Wiener Staatsopernorchester macht sich dagegen das Nichteinverständnis des Orchesters darin bemerkbar, dass der Dirigent immer wieder das Tempo forcieren muss. Aus der (berechtigten) Angst des Dirigenten, bei jedem Nachgeben würden die Musiker in ihr gewohntes Tempo zurückfallen, entsteht eine Atemlosigkeit, die dem Charakter der Musik mitunter diametral widerspricht (z.B. im 1. Satz der Pastorale).
8 auf Compact Discs der Labels Accord und VM-VAM-VMCC (Pauli 1993, 54)
© 2009 Christoph Keller. Alle Rechte vorbehalten.